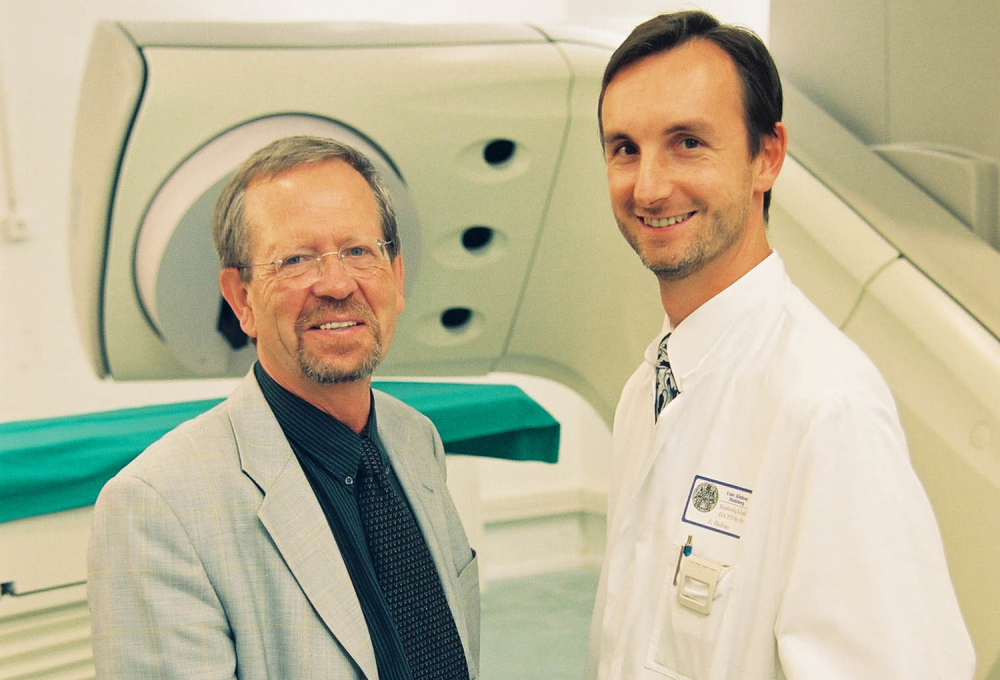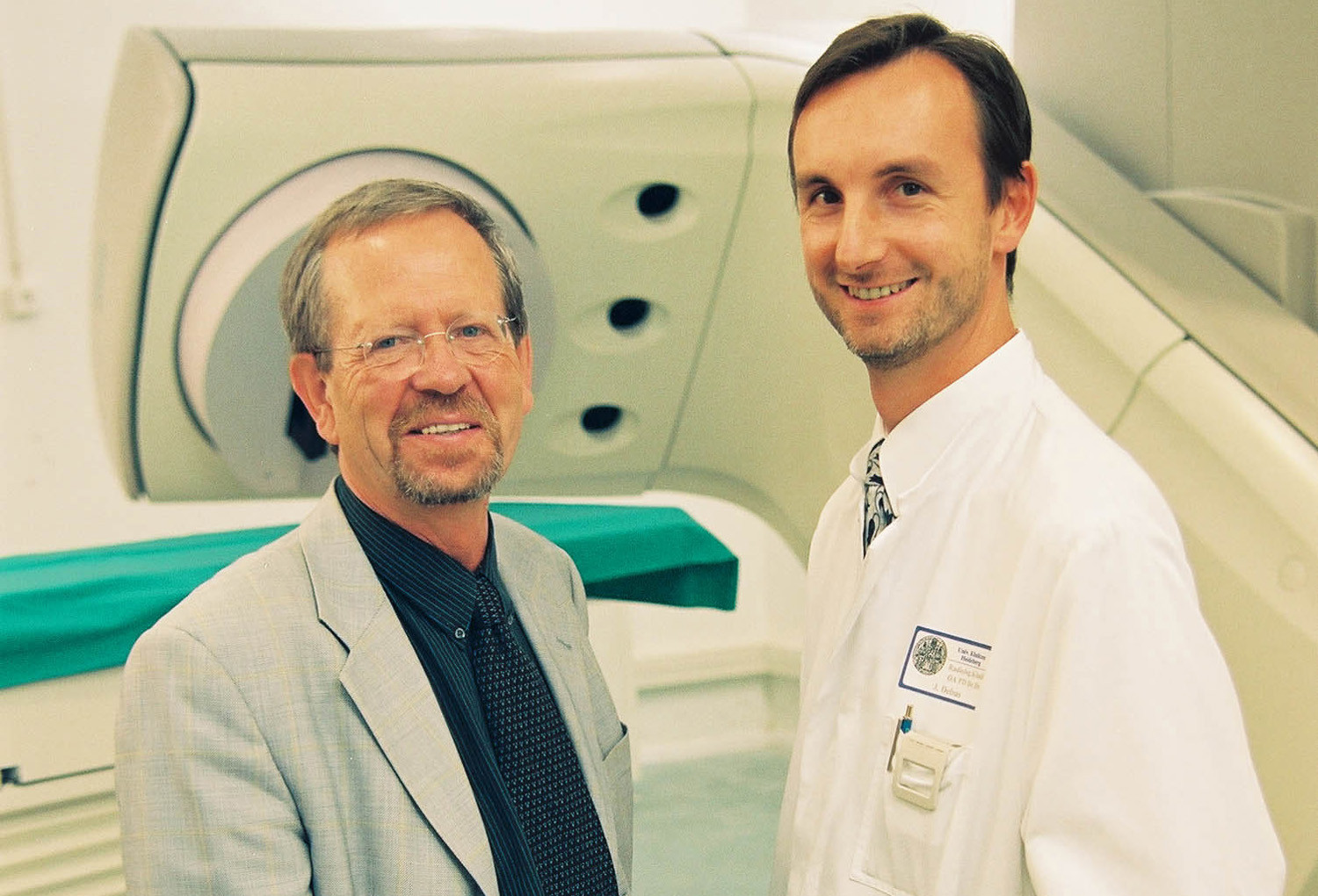Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Wir haben am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) vor etwa 20 Jahren begonnen, neue Strahlentherapieverfahren zu entwickeln, die darauf ausgerichtet waren, die Nebenwirkungen bei Strahlenbehandlungen zu senken und die Heilungsraten zu verbessern. Das Ganze begann mit einem Projekt zur Therapie von Hirntumoren. Es wurde hier ein Verfahren entwickelt, bei dem eine sehr, sehr hohe Strahlendosis in einer einzigen Sitzung verwendet wurde - normalerweise wird ein Patient viele Wochen lang behandelt. Dieses Verfahren war sehr erfolgreich und breitete sich dann auch auf der ganzen Welt aus. Das nächste Problem, das sich uns stellte, waren Tumore, die sehr kompliziert geformt sind. Wenn ein Tumor kompliziert geformt ist und daneben strahlensensibles Gewebe liegt, dann kann man nicht so hochdosiert bestrahlen, da man immer das gesunde Gewebe mitschädigt.
Haben Sie hier konkrete Beispiele?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Ein Tumor, der ganz in der Nähe des Sehnervs oder des Hirnstammes wächst - der Hirnstamm ist das verlängerte Rückenmark. Und wenn hier ein Tumor hufeisenförmig um den Hirnstamm herumwächst, dann kann man nicht hochdosiert bestrahlen, ohne den Hirnstamm mitzubestrahlen. Mit diesem Problem haben wir uns sehr lange beschäftigt. Und dann kam die Idee, von der normalen Bestrahlungstechnik abzuweichen, die darin besteht, dass mit gleichmäßig ausgeleuchteten Strahlenfeldern bestrahlt wird. Man kann das mit einer Glühbirne vergleichen, die in alle Richtungen gleichmäßig leuchtet. Die Idee war nun, Strahlenfelder einzusetzen, die ungleichmäßig ausgeleuchtet sind, und dies so vorauszuberechnen, dass man durch eine Überlagerung dieser Felder auch einen kompliziert geformten Tumor bestrahlen kann.
Das klingt zunächst alles etwas mystisch und schleierhaft. Die mathematischen Grundlagen hierzu sind relativ kompliziert. Das Prinzip besteht einfach darin, mit ungleichmäßig ausgeleuchteten Strahlenfeldern die Bereiche, wo die Strahlung gleichzeitig durch den Tumor und gesundes Gewebe dringt, weniger zu bestrahlen und dort, wo nur der Tumor getroffen wird, höher zu bestrahlen. Diese Strahlenfelder werden heute „intensitätsmodulierte Strahlenfelder“ genannt. Daher auch der Begriff „Intensitätsmodulierte Strahlentherapie“. Es steckt ein aufwendiges mathematisches Verfahren dahinter, das ausrechnet, wie solche Strahlenfelder ausgeleuchtet sein müssen, damit die Überlagerung mehrerer Strahlenfelder dann tatsächlich zu einer Strahlendosisverteilung führt, die das gesunde Gewebe ausspart und nur den Tumor mit Strahlung belastet. Mit diesem Verfahren, das heute „inverse Therapieplanung“ genannt wird, hat sich Herr Bortfeld in seiner Doktorarbeit 1988, als er als Doktorand bei mir anfing, unter Einbeziehung meiner Vorschläge beschäftigt und ein Computerprogramm entwickelt, das wir auch am Patienten einsetzen konnten - 10 bis 12 Jahre später. Als wir sahen, dass dieses mathematische Verfahren funktioniert und erfolgreich ist und wir damit komplizierte Tumore behandeln können, mussten wir einen zweiten Schritt gehen. Aufgabe war, die Beschleuniger, die die Strahlung erzeugen, so zu modifizieren, dass die intensitätsmodulierten Felder auch entstehen. Das war nicht ganz einfach. Bis dato konnte man eben nur die gleichmäßige Ausleuchtung erzielen. Dieser Schritt, die Umsetzung der Theorie, bestand darin, computersteuerbare Strahlenblenden einzusetzen, die während der Bestrahlung so verformt werden können, dass Intensitätsmodulation entsteht. Ein Beschleuniger erzeugt zunächst ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Strahlenfeld, ähnlich wie eine Glühlampe auch. Mit einer Blende wird dieses Feld eingeengt auf die Form des Tumors. Aber auch dann ist das Strahlenfeld noch gleichmäßig ausgeleuchtet. Der Trick besteht nun darin, dass man Metallblenden in den Strahlengang einführt und bestimmte Zeit im Strahlenfeld verweilen lässt. Sie mindern an bestimmten Stellen des Strahlenfeldes die Strahlung ab und lassen an anderen Stellen die Strahlung durch. Diese computersteuerbaren Strahlenblenden nennt man Multi-Leaf-Kollimatoren. Der nächste Schritt war nun, solche Multi-Leaf-Kollimatoren so anzusteuern, dass das, was wir in dieser inversen Therapieplanung vorausberechnet hatten, auch umgesetzt wird. Das geschah von den theoretischen Grundlagen her zunächst hier am DKFZ, aber es fehlte uns ein Beschleuniger mit einem Multi-Leaf-Kollimator, um unsere Ideen auch auszuprobieren. Thomas Bortfeld ging damals nach Amerika, an das MD Anderson Cancer Institute in Houston, die bereits eine solche Maschine hatten. Dort wurden die Computerprogramme weiterentwickelt und getestet, die wir für diesen zweiten Schritt brauchten. Das Memorial Sloan Kettering Cancer Institute in New York, unser amerikanisches Pendant sozusagen, hatte von unserer Arbeit gehört, und die fanden das hochinteressant. Sie haben Thomas Bortfeld, der gerade in Houston war, eingeladen. Er hat dort ein paar Wochen gearbeitet und quasi seine Computerprogramme dort gelassen. Das war dann auch die erste Klinik, die das Verfahren eingesetzt hat. Sie waren technisch schon etwas weiter als wir, aber sie konnten dies ohne unsere Programme nicht durchführen. Sie haben dann 1997 begonnen, Prostatapatienten mit diesem neuen Verfahren zu bestrahlen. In New York sind nun schon über 1.000 Patienten behandelt worden. Wir haben mit der klinischen Umsetzung Ende 1997 bei Patienten mit kompliziert geformten Hirntumoren begonnen. Das war unter der Leitung von Jürgen Debus, der die Verantwortung für die klinische Seite des Projektes hatte. Wir beiden Physiker, Herr Bortfeld und ich, haben sozusagen die Grundlagen geschaffen, er war dann so mutig und hat das als erster in Europa in die Praxis eingeführt. Wir haben dann gesehen, dass unser Verfahren etwas ist, was eigentlich in jeder Strahlenklinik in Europa gebraucht wird. Ich habe überlegt, wie wir diese Programme möglichst schnell verkaufen und verbreiten können, damit sie überall eingesetzt werden können. Also gründeten wir eine kleine Firma, MRC. Einige meiner Doktoranden und Mitarbeiter sind dann in diese Firma übergewechselt, Physiker und Informatiker, die mit diesem Programm schon vertraut waren. Sie haben dann in der Firma die Programme so weit überarbeitet, dass ein zugelassenes, zertifiziertes Produkt daraus wurde. Diese Programme werden heute verkauft und auch schon in Kliniken eingesetzt. Es fing an mit den ersten grundlegenden Schritten Ende der 80er Jahre, über den klinischen Einsatz in den 90ern bis zur kommerziellen Umsetzung Ende der 90er.
Gehen wir noch mal auf den Begriff der Innovation zurück. Ist diese nun eine konsequente Entwicklungslinie gewesen oder gab es irgendwann mal den Punkt, an dem Sie sagten, ja, das ist es?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Das war eigentlich 1988. Herr Bortfeld kam zu mir ins Büro und sagte, er sei Physiker, wolle promovieren und suche ein Thema. Ich hatte eines: Ein paar Tage zuvor war ein schwedischer Kollege bei mir gewesen, der mir über seine Probleme bei der Optimierung der Strahlentherapie-Planung erzählte, wie schwierig das alles sei. Er hat mich auf Veröffentlichungen aufmerksam gemacht, die schon vor vielen Jahren erschienen sind und das Problem der Optimierung von Strahlentherapie-Plänen behandeln. Ich habe mich in diese alte Literatur vertieft und gesagt: hoppla, so könnte es auch gehen, anstatt dieser gleichmäßig ausgeleuchteten Felder könnten wir mal diese ungleichmäßigen Felder ausprobieren. Ich habe mit dem Kollegen in Stockholm telefoniert und ihm gesagt, dass wir diesen Ansatz ausprobieren wollen. Er sagte, er wolle es gleichzeitig in Schweden auch probieren. Im Gegensatz zu den schwedischen Kollegen haben wir unsere Arbeit konsequent auf dieses Thema konzentriert. Am Schluss hat meine halbe Abteilung, immerhin 20 Leute, intensiv an dem Problem gearbeitet. Es hört sich alles so leicht an, aber im Endeffekt sind das 30-40 Mannjahre Entwicklung, die hier drinstecken. Es gab also tatsächlich einen Punkt, einen Impuls. Das war der Besuch meines schwedischen Kollegen, mit dem ich über das Thema diskutiert habe, das muss ich ganz klar sagen. Leider sind die Schweden nicht so erfolgreich gewesen, sie haben sehr gut theoretisch gearbeitet und theoretische Ansätze veröffentlicht, aber es ist dort nie ein Patient bestrahlt worden, und es gab dort keine praktische Umsetzung.
Dieses Projekt ist ja für den Laien eine Mischung aus Technik und Medizin. Wie sind die Verzahnungen? Haben Sie immer erst das eine entwickelt und dann kam der Mediziner dazu oder wie kann man sich das vorstellen?
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Das ist ja hier das Besondere am Deutschen Krebsforschungszentrum, hier saßen Mediziner, Physiker, Informatiker nebeneinander und aus der Diskussion der täglichen Probleme hat sich die gegenseitige Inspiration entwickelt. Das war der wesentliche Unterschied. Für lange Jahre war es so, dass diese Arbeitsgebiete getrennt waren, man sich dann beim Patienten wieder traf, aber die Entwicklung häufig nicht zielgerichtet mit gegenseitiger Hilfe geschah. Bei diesem Projekt war von Anfang an der Dialog da. Aus dem medizinischen Problem wurde eine physikalische Lösung; die physikalische Lösung - hat der Mediziner gesagt - ist auch ein neuer Ansatz für die Patientenbehandlung, und wir könnten hier eine Anwendung generieren. Das ist der große Fortschritt der letzten Jahre, dass man diese Forschung nicht geradlinig planen kann, sondern aus dem Dialog die Möglichkeiten entstehen, die der Einzelne in seinem Fachbereich gar nicht so sieht.
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Unser besonderes Glück war zum einen unsere enge Zusammenarbeit und auch der Umstand, dass Herr Debus Arzt und Physiker ist - es gibt wirklich oft eine Sprachbarriere zwischen Naturwissenschaftlern und Ärzten, die zu überwinden gar nicht so einfach ist. Herr Debus war sozusagen unser Interface, der beide Seiten gut verstanden hat. Und das ist ganz wichtig. Vieles scheitert daran, dass die verschiedenen Disziplinen ihr ganz eigenes Vokabular haben und die Ideen gar nicht transportieren können. Man verschanzt sich hinter seinem Fachchinesisch und der andere versteht einen nicht. Herr Debus konnte also glücklicherweise uns verstehen und sich auch verständlich machen.
Was hat Sie bewogen, Physik und Medizin zu kombinieren?
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Ich habe zunächst mit dem Studium der Medizin begonnen und dann festgestellt, dass es mich nicht ganz ausfüllt. An der Physik habe ich immer das Transferdenken geschätzt, sich von einer Aufgabe zur nächsten zu entwickeln, Analogschlüsse zu ziehen, das macht viel Spaß. Und letztendlich gab Professor Bille, den ich im Grundstudium kennengelernt hatte, einen Anstoß. Er meinte, es sei eine gute Idee, dass wir eine kleine Gruppe von Medizin-Physikern zusammenstellen, die das kombinierte Studium Medizin-Physik betreibt. Er hat relativ früh festgestellt, dass hier eine Lücke besteht, dass Mediziner und Physiker häufig nicht miteinander reden, weil sie einfach unterschiedliche Sprachen sprechen.
Sie haben eben eine Entwicklungskette dargestellt. In welchem Stadium der Erprobung sind Sie und was stellt sich in der Folge noch dar? Kann man skizzieren, wo das jetzt noch hingehen kann, oder sagen Sie, wir haben einen Fixpunkt erreicht und das wird ein Standard für eine bestimmte Zeit?
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Die Entwicklungslinie, die Herr Schlegel dargestellt hat, war auch davon geprägt, dass wir vor 20 Jahren keine Schnittbildverfahren hatten. Durch die Arbeiten von Herrn Schlegels Abteilung ist es gelungen, den Tumor und die Strahlen zu visualisieren. Und das ist der Schritt der sogenannten „dreidimensionalen Strahlentherapie“. Die gab es bis vor 10 Jahren nur im engen Forschungsbereich, heute ist sie so verbreitet, dass jedes Kreiskrankenhaus über diese Möglichkeit verfügt. Und wenn man jetzt die Entwicklung, die Dynamik sieht, ist die intensitätsmodulierte Strahlentherapie eine konsequente Fortsetzung dieses Gedankens. Insofern ist anzunehmen, dass vielleicht in 5 Jahren auch die Kreiskrankenhäuser über diese Technik verfügen und sie einsetzen werden. Eine direkte Verbreitung und Umsetzung ist hier meine Prognose.
Im Moment wird ja viel über Gentherapie geredet und das wird vielleicht auch die „konventionellen“ Therapien irgendwann ablösen. Sehen Sie das auch so, oder ist das eher das Mittel der Wahl, was hier passiert?
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Wir sitzen hier ja sozusagen am Puls der Entwicklung der ganzen molekularbiologischen, auch chemotherapeutischen Verfahren. Das DKFZ hat 2.000 Mitarbeiter, wir arbeiten mit etwa 150 Mitarbeitern an dem radiologischen Verfahren. Wenn diese Erkenntnis bestünde, müsste unser Vorstand den radiologischen Bereich stilllegen, weil er nicht zukunftsträchtig sei. Die Notwendigkeit der Strahlenverfahren wird auch dadurch verdeutlicht, dass in der täglichen Anwendung in Deutschland pro Jahr ca. 200.000 Patienten bestrahlt werden. Dies ist Bestandteil der Tumorbehandlung von Krebspatienten, und es gilt, dort Verbesserungen zu erreichen. Sicherlich gibt es im Moment äußerst interessante Entwicklungen in der Molekularbiologie und in der Gentherapie, die in der Erprobungsphase sind. Aber sie sind noch weit davon entfernt, das Krebsproblem allgemein lösen zu können. Und vermutlich wird es so sein, dass man in Zukunft - vielleicht in den nächsten 20 Jahren - beide Verfahren zusammen einsetzt, dass man die große Tumormasse im Strahlenverfahren vernichtet und dann die Gentherapie einsetzt, um zu verhindern, dass der Tumor wiederkommt.
Können Sie nochmals die Verbesserungen, die sich durch die Therapie für den Patienten ergeben, darstellen?
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Wir können hier quantifizieren. Bei Patienten, die wir früher in einem bestimmten Dosisbereich bestrahlten, sind die Heilungsraten besser geworden: Bei Prostatakrebs wären früher bei 30-40% schwere Nebenwirkungen bei entsprechender Dosierung aufgetreten, und heute können wir das bei weniger als 1% der Patienten in dieser Weise sehen. Sie können das für den Patienten schon quantifizieren, nur ist es für den Laien äußerst schwer verständlich, wenn wir mit solchen Prozentzahlen argumentieren.
Wir können aufzeigen, dass wir heute Tumoren behandeln, die früher als absolut unbehandelbar galten, Tumore die sich auf der Lungenoberfläche ausbreiten, die Krebsarten, die durch Asbest ausgelöst werden. Sie galten strahlentherapeutisch als völlig unbehandelbar. Hier können wir eine Heilung durch Oberflächenbestrahlung erreichen, und das ist eigentlich das Faszinierendste für uns. Es gibt Tumore im Kopf- und Halsbereich, die man durch Strahlentherapie - das wusste man schon länger - sehr gut heilen kann. Wir erreichen eine Heilungsrate von 80%. Der Preis, den der Patient früher dafür bezahlen musste, war dass alle Speicheldrüsen im Mundbereich ihre Funktion einstellen. Das hat zur Folge, dass der Patient eine ständige Mundtrockenheit hat, seine Zähne verliert, weil der Speichel eine Schutzfunktion für die Zähne hat. Letztendlich führte das zur Berufsunfähigkeit, wenn er in einem sprechenden Beruf gearbeitet hat. Es gab auch Patienten, die sich suizidiert haben aus dieser Problematik heraus. Der Patient muss nicht mehr diesen Preis für die Tumorheilung zahlen. Und dies ist gerade auch bei Kindern sehr eindrücklich. Zum Beispiel bei Gehirntumoren bei Kindern kommt es nicht mehr zur Verschiebung des Schädelknochens auf Grund unterschiedlichen Wachstums, da nach der herkömmlichen Therapie langfristig ein Knochen das Wachstum einstellt. Heute sieht man dem Kind eben nach 2 bis 3 Jahren nicht an, dass es bestrahlt wurde. Das sind für uns enorm spektakuläre Dinge.
Wie setzt sich das gesamte Team zusammen und was ist von den einzelnen Mitgliedern in das Projekt eingebracht worden?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Ich hatte ja meinen Kollegen Thomas Bortfeld erwähnt, er ist Physiker. Er ist damals als Doktorand zu mir gekommen und hat in sehr kurzer Zeit das mathematische Problem in seiner Doktorarbeit gelöst. Anschließend hat er eine Zeit lang hier gearbeitet, dann in Amerika, dann hat er sich bei Professor Bille in angewandter Physik habilitiert. Von 1988 bis 2001 hat er an dem Projekt als der theoretische Kopf gearbeitet. Er ist bereits weltweit bekannt auf Grund seiner theoretischen Arbeiten. Das Verfahren, den Multi-Leaf-Kollimator eines Beschleunigers zu steuern, ist unter seinem Namen bekannt. Zu Beginn dieses Jahres hat er einen Ruf an die renomierte Harvard-Universität bekommen. Er arbeitet jetzt im Massachusetts General Hospital in Boston, das ist ein berühmtes Krebskrankenhaus, das zur Harvard-Universität gehört. Dort hat er als neue Aufgabe übernommen, eine Protonentherapieanlage, also einen Teilchenbeschleuniger, in der Krebstherapie einzuführen.
Auch Herr Debus ist schon lange hier am Institut. Er hatte sowohl als medizinischer wie physikalischer Doktorand mit Ultraschall gearbeitet, bis er sich entschlossen hat, hier in Strahlentherapie seinen Facharzt zu machen und sich zu habilitieren. Er leitet jetzt am DKFZ die Abteilung strahlentherapeutische Onkologie. Er hat eine Doppelfunktion als Oberarzt an der Uniklinik und als Leiter einer Forschungsabteilung im DKFZ. Das ist für uns natürlich von ganz besonderem Interesse, weil er sozusagen das eine Bein in der Klinik und dort den Kontakt zu den Patienten hat. Und ganz besonders wichtig für uns ist natürlich auch seine naturwissenschaftliche Ausbildung.
Ich selber habe hier am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg meine Diplom- und Doktorarbeit absolviert und auch eine Zeit lang als Kernpysiker gearbeitet. Dann kam mir die Kernphysik jedoch relativ trocken und anwendungsfern vor, und ich habe mich manchmal abends gefragt, was hast du da heute überhaupt gemacht? Es gab auf der Welt so ungefähr noch drei andere Kollegen, die verstanden haben, was ich mache. Also wollte ich mir etwas suchen, was anwendungsorientierter ist und bin so 1973 ans DKFZ gekommen. Ich habe mich erst mit der nuklearmedizinischen Diagnostik von der physikalischen Seite her beschäftigt. Dann gab es einen Kontakt zum Forschungszentrum in Karlsruhe, das damals noch ein reines Kernforschungszentrum war. Dort war die Erfindung einer Neutronenbestrahlungsanlage gemacht worden. Wir beschlossen am DKFZ, diese Anlage auszuprobieren und zu untersuchen, ob sie für Patienten wirklich Vorteile gegenüber der normalen Bestrahlung mit Röntgenstrahlen bringt. Das war eigentlich der Einstieg des Krebsforschungszentrums in die Strahlentherapie. Es hat sich bald gezeigt, dass diese Neutronen nur sehr begrenzt zur Behandlung einsetzbar waren. Um die Neutronen vergleichen zu können mit dem, was normalerweise in Krankenhäusern gemacht wird, wurde hier am DKFZ ein Linearbeschleuniger beschafft. Dann haben wir gemerkt, dass wir - wenn wir die Computerplanungsverfahren und die neuen bildgebenden Techniken einsetzen - mit dem herkömmlichen Therapieverfahren viel weiter kommen als mit den Neutronen. Die Neutronen hat man wieder fallen lassen und wir sahen die Möglichkeiten der Verbesserung der „konventionellen“ Strahlentherapie mit Beschleunigern unter Einbeziehung der bildgebenden Verfahren - Computertomographie, die in den 70ern gerade aufkam, und eben der dreidimensionalen Strahlentherapie-Planung. Ich habe eine kleine Gruppe von Informatikern, Ingenieuren und Physikern gebildet, die die dreidimensionale Strahlentherapie-Planung entwickelt haben. Das Kunststück war, mit einem unsichtbaren Strahl einen bis dato unsichtbaren Tumor zu treffen. Das Problem haben wir dadurch gelöst, dass wir es in den Computer verlagert haben. Wir haben Computerprogramme entwickelt, mit denen die Strahlentherapeuten ihre Behandlung vorausmodellieren konnten.
Das war der erste wichtige Schritt. Auch damals hatten wir schon Kontakte zur Industrie. Die Firma Siemens und andere haben dann diese Programme weltweit verbreitet. Für unser Verfahren wurde uns auch der Karl Heinz Beckurts-Preis für Technologietransfer verliehen.
1988 habe ich einen Ruf an die Freie Universität in Berlin bekommen, um dort eine Professur für Medizinische Physik aufzubauen - aber da war die Arbeit hier so im Gange, dass es mir Leid getan hätte, das alles zu verlassen. Ich bin hier geblieben und wir haben diese Dinge entwickeln können. Im Nachhinein bedaure ich auch nicht, nicht nach Berlin gegangen zu sein.
Und das Faszinierende war, dass wir hier in einem Team von Ärzten, Physikern, Informatikern und Ingenieuren das Projekt in hervorragender Zusammenarbeit entwickeln konnten. Es tut mir jetzt Leid, dass hier nur ein oder zwei Kollegen hervorgehoben werden, die nominiert sind, eigentlich stehen noch weitere 40 Leute im Hintergrund.
Lassen Sie uns auf die wirtschaftliche Umsetzung eingehen, die eine sehr wichtige Komponente des Deutschen Zukunftspreises ist. Es ist ja in Deutschland immer noch nicht so ganz üblich, dass sich aus der Wissenschaft und Forschung heraus ein Wirtschaftsunternehmen entwickelt. Können Sie das kurz darstellen? Was hat Sie bewogen, das hier selbst zu initiieren?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit großen Firmen: dass Dinge zwar aufgegriffen wurden, aber es ging oft viel zu zäh und zum Schluss wurde nichts daraus gemacht. Unsere Vorstellung war, dass die Entwicklungen auch schnell verbreitet werden sollten. Demzufolge haben wir 1995 die Firma gegründet. Da war es in Deutschland ja noch fast unanständig, sich als Wissenschaftler mit der Vermarktung seiner Ideen zu beschäftigen. Inzwischen hat sich das geändert, aber es gab zu Beginn erhebliche Probleme und Widerstände und nicht nur positive Erlebnisse bei dieser Firmengründung. Allerdings muss ich sagen, dass der Vorstand dieses Hauses schon damals die Bedeutung des Technologietransfers sah und uns von Anfang an sehr unterstützt hat. Das Kunststück war eigentlich erst einmal, die Geldgeber aufzutreiben, die in eine so wacklige Sache investieren. Wir hatten das Glück, vier mittelständische Unternehmen zu finden, aus dem Heidelberger Umfeld, die bereit waren, in bescheidenem Umfang zu investieren. Dann haben wir ein EU-Förderungsprojekt von 2 Millionen Mark für die Firma bekommen. Als dann die größeren medizintechnischen Firmen gesehen haben, wie interessant diese neue Sache ist, haben sich Vertriebswege geöffnet von dieser kleinen Firma zu großen internationalen Firmen. Dann hat sich alles relativ schnell entwickelt. Heute arbeiten rund 35 Mitarbeiter in der Firma. Auch das Forschungsministerium hat, als es auf die Firma aufmerksam wurde, durch Kredite geholfen. Ein weiterer Vorteil war natürlich, dass Mitarbeiter hier aus meiner Abteilung, Diplomanden, Doktoranden aus der Physik und Informatik, in die Firma überwechseln konnten und einen interessanten Arbeitsplatz gefunden haben. Sie haben ihr Wissen mit herübergebracht und konnten nahtlos weiterarbeiten. In der Tat treten manchmal Abgrenzungsprobleme zwischen der wissenschaftlichen Arbeit hier und den kommerziellen Aspekten dort auf, aber bisher haben wir diese Abgrenzung durch Kooperationsverträge zwischen dem Forschungszentrum und der Firma ganz gut gelöst. Ein wichtiger Aspekt ist für uns auch, dass die Firma jetzt zugelassene Geräte und Computerprogramme entwickelt, die wir dann sicher an Patienten einsetzen können.
Innovation, jeder benutzt diesen Begriff. Was ist Innovation für Sie und wie definieren Sie das im Zusammenhang mit dem Projekt?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Innovation hat etwas mit Kreativität zu tun. Wenn ich mir meinen Tagesablauf anschaue, dann habe ich immer seltener Zeit, innovative oder kreative Ideen zu entwickeln. Unter den Bedingungen, unter denen wir derzeit forschen und arbeiten müssen, kommen Innovationen und Kreativität in zunehmendem Maße immer kürzer. Wir werden zugedeckt mit einem fürchterlichen administrativen Aufwand, sprich Berichte schreiben, Anträge schreiben. Man muss sich den Freiraum für Kreativität wirklich erkämpfen. Der besteht bei mir manchmal darin, dass ich eine Woche lang einfach nicht hierher komme und mich zu Hause vergrabe und versuche, die Literatur aufzuarbeiten, die es weltweit gibt, und mir irgendwie Zeit nehme, Standortbestimmung zu machen: Was machen wir eigentlich und wo soll es hingehen. Das kommt leider immer viel zu kurz. Oft entstehen Innovationen eben nicht geplant sondern zufällig. Diese Sache hier war mehr oder weniger Zufall. Hätte mich der schwedische Kollege damals nicht besucht, wäre es nicht dazu gekommen. Und solche Gelegenheiten sind leider viel zu selten, dass man die Zeit hat, sich einfach mal mit einem Kollegen hinzusetzen, ein Brainstorming macht und die Gedanken laufen lässt. Und nur unter solchen Randbedingungen, meine ich, kommen solche innovativen „Geschichten“ zustande. Ein Mitarbeiter und Kollege, Otto Pastyr, der Ingenieur hier im Team, jetzt im Ruhestand, hat im Laufe seiner Mitarbeit über 50 Patente angemeldet. Wenn er in Kur geschickt wurde, kam er sprudelnd mit neuen Ideen zurück. Und das hat mir immer wieder gezeigt, dass das normale Arbeitsgeschehen eher innovations- und kreativitätshemmend ist. Ich mache mir zur Zeit viele Gedanken, was zu tun ist, um das bei den jungen Leuten wieder zu fördern, also ein kreativitätsförderndes Arbeitsklima zu erreichen. Weiter ist meine Überzeugung, dass alleine im stillen Kämmerlein nicht viel passiert, sondern Innovation heute vor allem im interdisziplinären Bereich stattfindet. Wenn sich zum Beispiel wie hier Physiker, Mathematiker, Ingenieure und Ärzte zusammensetzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Innovatives entsteht, noch am größten.
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Wenn man Innovationen möchte, braucht man schon kreative Leute - das ist Bedingung. Aber man braucht nicht nur den, der die Ideen hat, sondern auch den Macher. Und es ist eigentlich das Zusammenspiel der verschiedenen Leute, was kreative Produktivität ausmacht. Es gibt Leute, die sprudeln vor Ideen, aber in ihrem Kämmerlein, und es ist kein Macher an ihrer Seite. Bei diesem Projekt gab es die Ideen, den Macher, die kritische Stimme usw., um es umsetzen zu können. Wenn man die Innovativen von den Nichtinnovativen unterscheidet, dann sind bei denen, die kein innovatives Ergebnis vorzuzeigen haben, trotzdem viele innovative Ideen da, aber die Umsetzung fehlt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man eine Atmosphäre haben muss, in der man frei und ungezwungen zusammenarbeiten kann und die verschiedenen Geister aufeinandertreffen können.
Eine Zielsetzung dieses Preises des Bundespräsidenten ist es, den Dialog Wissenschaft - Öffentlichkeit zu unterstützen, zu fördern. Ihr Projekt ist auf Grund der medizinischen Relevanz vielleicht sogar etwas bekannter als dies bei vielen innovativen Projekten der Fall ist. Was tun Sie für den Dialog mit der breiten Öffentlichkeit?
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Wir sind in einem Bereich tätig, der von starkem journalistischem Interesse ist, und wir tun relativ viel für die Information der breiten Öffentlichkeit. Wir nutzen verschiedene Medien, sei es jetzt, dass wir Berichte schreiben, nicht nur wissenschaftliche sondern auch populärwissenschaftliche, bis hin zu ganz populären Dingen, die dann weite Verbreitung finden. Wir haben jetzt einen Filmbeitrag gedreht, der die Arbeiten hier darstellt. In der Medizin ist man immer relativ nah an der Öffentlichkeit. Wir sind nicht die Forscher, die sich in ihr Labor zurückziehen, sondern wir reden mit dem Patienten, also in der Regel mit einem medizinischen Laien, um ihm verständlich zu machen, was hier das Besondere ist, warum man ihn so und so behandeln möchte. Dann haben wir natürlich auch relativ viele Patienten- und Presseanfragen. Wenn es heißt, es gibt ein neues Verfahren, kommt natürlich umgekehrt die Presse und will wissen, was jetzt das Neue daran ist.
Gibt es so etwas wie ein „Motto“, eine formulierbare Motivation für das, was Sie tun? Was treibt Sie an?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Strahlentherapie ist ein lokal begrenztes Verfahren. Das „Motto“, das wir uns damals gesetzt haben, war, neue Verfahren zu entwickeln, die bei Patienten mit lokal wachsenden Tumoren die Nebenwirkungen senken und die Tumorrückbildung begünstigen: also Erhöhung der Effizienz und Senkung von Nebenwirkungen. Und dazu wollen wir das ganze Instrumentarium von Mathematik, Physik und Technik einsetzen.
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Vor Kurzem hat ein Großteil der Abteilung bei einem Triathlon mitgemacht und die Staffel hieß „Alle gegen einen“. Und das hat sich ein bisschen durchgesetzt. Das ist zwar jetzt ein ganz anderer Bereich, dort geht es darum, dass einer zwei Kilometer schwimmt, der Nächste 40 Kilometer Rad fährt und wieder der Nächste zehn Kilometer läuft. Hier sind Physiker, Mediziner usw. miteinander gerannt und haben sich das „Staffelholz“ überreicht, und alle hatten ein T-Shirt an mit dem Motto „Alle gegen einen“ - den Krebs. Also wenn es ein Motto unserer Abteilungen gäbe, wäre dies ein geeignetes.
Wie schätzen Sie das Klima für Forschung und Innovation in Deutschland im Moment ein und wie stehen wir im internationalen Vergleich da?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Eine schwierige Frage. Ich bin Medizinphysiker und kann eigentlich nur für diesen Bereich sprechen. Es ist leider so, dass in Deutschland dieses Gebiet mehr oder weniger Dienstleistungsdisziplin in den Krankenhäusern ist, auch in den Universitätskliniken. Und es gibt in der Bundesrepublik nur ein oder zwei Zentren, wo auf dem Gebiet der Medizinphysik innovativ und kreativ gearbeitet werden kann. An den Universitätskliniken, die auch den Auftrag der Forschung hätten, ist dieses Gebiet leider total unterrepräsentiert. Es gibt einen einzigen Lehrstuhl für Medizinische Physik in Tübingen, sonst sind alle Abteilungen und Lehrstühle inzwischen geschlossen worden. Das macht es uns hier in Heidelberg möglich, als „Insel der Seeligen“ auf diesem Gebiet in Deutschland eine Stellung einzunehmen, die einzigartig ist. In Deutschland haben wir keine ernsthafte Konkurrenz.
International gesehen, sieht es natürlich ganz anders aus. Es gibt große Institute und Forschungszentren mit großen Medizinphysikabteilungen, so das Karolinska Institut in Stockholm, wo der schwedische Kollege herkam, oder das Royal Marsden Hospital in England, eine berühmte Krebsklinik - in Amerika gibt es mehrere Zentren, auch in Holland und Frankreich. Aber auch international gesehen, denke ich, haben wir eine recht gute Stellung, wir werden als leitende und führende Gruppe anerkannt. Das hat sich zum Beispiel dadurch dokumentiert, dass wir große internationale Kongresse auch hier nach Heidelberg bekommen. Für mein relativ begrenztes Fachgebiet sieht es in Deutschland nicht besonders rosig aus. Wir haben wirklich Glück, dass an einem Großforschungszentrum wie dem DKFZ eine solche Abteilung existieren kann und auch ihren Aufgabenbereich hat. In der Hochschullandschaft dagegen sieht es nicht sehr günstig aus. Dann kommt auch dazu, dass die Physiker heute insgesamt sehr gute Arbeitsmöglichkeiten in der Industrie haben. Ich tue mich neuerdings sehr schwer, junge Leute zu motivieren, in diesem Gebiet arbeiten zu wollen. Die gehen lieber in die Softwareentwicklung und verdienen sich da goldene Nasen. Zudem ist die Zahl der naturwissenschaftlichen Studenten in den letzten fünf Jahren fast um die Hälfte abgesunken. Insofern habe ich große Bedenken, wie es hier weitergehen soll. Die medizintechnische Industrie alleine kann solche Entwicklungen, wie wir sie hier durchführen, nicht leisten. Da fehlt der Bezug zur Anwendung und die Interdisziplinarität. Auch in den Universitäten ist das Umfeld nicht gegeben, es kann also nur in Zentren wie hier geschehen.
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Gerade im internationalen Vergleich steht die deutsche Forschung sehr hoch im Renomee; sie gilt als sehr gründliche, konsequent umgesetzte Forschung. Was die deutsche Forschung nicht so gut kann, ist, sich zu präsentieren und sich nach außen zu verkaufen. Wir haben tolle Wissenschaftler, die jedoch das, was sie überhaupt machen, nicht artikulieren können, warum sie das machen und was die besondere Relevanz ihrer Tätigkeit ist. Das ist ein Manko. Und dann muss man sicherlich an der einen oder anderen Stelle nachhaken. Es gibt sicher noch immer einige Privatgelehrte, die sich in ihr Kämmerlein zurückziehen.
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Außerdem ist es so, dass die Gesellschaft einfach technisch und naturwissenschaftlich desinteressiert ist. Das sehe ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis immer wieder. Wenn man sich trifft, spricht man stundenlang über Politik, aber ich habe selten erlebt, dass man über Naturwissenschaft auch nur in Ansätzen reden will. Das hat man mit dem Abitur spätestens abgehakt und will davon nie wieder was wissen. Ich sehe das an meinen Kindern, die sind derartig demotiviert vom Schulunterricht in naturwissenschaftlichen Fächern. Man kann das so spannend und interessant machen, aber die Schule bringt das nicht rüber, und das ist eine der Wurzeln des Übels.
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Das Problem liegt auch bei den Medien. Wenn wir heute die Diskussion über die Stammzellforschung hören, dann werden die Forscher der Gesellschaft gegenübergestellt, als ob die Forscher nicht Teil der Gesellschaft wären, sondern eine Spezies, die etwas ganz Verrücktes machen will. Es ist ein Stück weit ein Problem des Journalismus, dass das hier auf diese Weise polarisiert wird. Sicherlich ist das dann sehr interessant, wenn man polarisiert, aber es ist sicher nicht im Sinne des Ganzen.
Was ist zu ändern, wo sollte man ansetzen?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Ich würde wirklich im Schulbereich anfangen und einen völlig anderen Unterricht machen, was Chemie, Physik und Mathematik angeht - anwendungsbezogen. Die Schüler müssen raus und sehen, wo wird das eingesetzt, welche praktische Relevanz hat das.
Es gibt hier in Heidelberg ein Projekt, „Science Lab“. 200 Schüler nehmen regelmäßig an Veranstaltungen teil, die im DKFZ durchgeführt werden. Sie werden durchs Zentrum geschleust, hören Vorträge, sehen im Labor vor Ort, was da gemacht wird. Dabei erlebt man, dass man junge Leute begeistern kann. Das wäre das erste, was ich machen würde: einen praxisbezogenen, lebendigen Unterricht. Aber dazu braucht man erst mal die Lehrer, die das können und das ist ein Teufelskreis. Wir haben in Heidelberg im Moment nur noch ganz wenige Studenten, die Physik im Lehrfach machen wollen.
Die Polarisierung von Wissenschaft und Forschung auf der einen und Gesellschaft auf der anderen Seite ist ein Problem, das ist eine üble Geschichte, die ich im Ausland so noch nicht kennengelernt habe, weder in England noch in Amerika. Dort verschmilzt das, dort gibt es ein ganz anderes Interesse. Die Forscher sind zum großen Teil aber auch selbst daran schuld. Einem Laien zu erklären, was man macht, fällt vielen Forschern sehr schwer. Ich übe das mit meinen Mitarbeitern. Wir gehen als Forschungsinstitut zum Beispiel auf die Hannover Messe. Meine Leute werden verdonnert und ich sage, ihr geht jetzt 8 Tage dahin und erzählt mal den Leuten, die da vorbeikommen, was ihr macht. Anfangs ist das oft eine Katastrophe. Es sind intelligente Leute, die summa cum laude promoviert haben, trotzdem können sie einem normalen Menschen nicht erklären, was sie eigentlich machen. Das muss geprobt und geübt werden. Im Deutschen Museum in München hatte die Helmholtz-Gemeinschaft letztes Jahr eine wissenschaftliche Ausstellung, bei der viele tausend Kinder vom Kindergarten bis hoch zu Abiturklassen durchgeschleust wurden; wir haben uns mit einem Ausstellungsstand beteiligt. Junge Wissenschaftler müssen in ihrer Ausbildung üben, was es heißt, sich verständlich zu machen. Wir werden aus Steuergeldern bezahlt und sind auch verpflichtet, den Steuerzahlern zu erklären, was wir machen.
Wenn Sie jetzt so zurückblicken und Sie ständen vor der Entscheidung, das, was Sie getan haben, nochmal zu tun, würden Sie etwas anders machen?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Im Großen und Ganzen würde ich den Berufsweg ähnlich wählen. Schon von der Veranlagung, vom Interessensgebiet her käme nichts anderes in Frage, da ich eine derartige Niete in Sprachen bin. Als Mediziner hätte ich mich auch nicht geeignet, also blieb mir nichts anderes übrig als die Naturwissenschaften. Aber ich würde mich nicht noch einmal in eine administrative Ecke drängen lassen, sondern versuchen, mir mehr Freiräume für Kreativität in der Forschung zu schaffen. Vieles von dem, was ich als Abteilungsleiter mache, hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Das ist Management und Verwaltung, Dinge, die ich nie gelernt habe, die ich eigentlich nie habe machen wollen.
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Ich habe noch keinen Schritt bereut.
Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht hier sitzen, womit entspannen Sie sich?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Ich bin zum Glück Besitzer eines großen Gartens. Gartenarbeit ist ja etwas, wobei man schön entspannen kann, man sieht hinterher, was man gemacht hat. Im Winter habe ich dann Stapel von Holz, die ich hacke. Das ist für mich eine absolut befriedigende und produktive Tätigkeit. Sonst bleibt eigentlich nicht viel Zeit. Ich verbringe meinen Urlaub zu Hause. Es ist einfach kein Beruf, in dem man um 17 Uhr den Bleistift fallen lässt und sagt, so, jetzt gehe ich meinen Hobbys nach. So ist es leider nicht. Es gibt Dinge, die ins Privatleben einwirken und einen stundenlang weiter beschäftigen.
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Wir arbeiten hier so ungefähr 60 Stunden in der Woche. Wenn man dann noch eine Familie mit zwei Kindern hat, die auch noch etwas von einem haben wollen, wenn man noch das abzieht, was man an den Wochenenden auf Kongressen usw. verbringt, da bleibt nicht viel Zeit für irgendwelche ausgefallenen Sportarten oder Freizeitinteressen, das ist stark limitiert.
Letzte Frage: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Ich denke wir sind noch lange nicht am Ziel. Man wünscht sich natürlich, dass eine Weiterentwicklung stattfindet, dass eine noch größere Breitenwirkung erzielt wird. Damit sind wir noch lange nicht am Ende. Ich wünsche mir, dass wir die begonnenen Schritte konsequent weiterführen können. Mit unserer Kunst stoßen wir immer wieder an Grenzen und der Wunsch wäre, dass wir diese Grenzen, zumindest partiell, sprengen können.
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Dass man irgendwann in der Zukunft an einen Punkt kommt, dass man dem Patienten, sagen kann, die Chance, dass wir dich heilen können, liegt bei 98% und das auch bei großen Problemtumoren. Man hat immer den Eindruck, dass Mediziner abhärten - eher das Gegenteil ist der Fall. Beispielsweise haben wir gestern eine 40-jährige Frau mit einem metastasierten Tumor behandelt, eine Mutter von zwei Kindern. Es ist unglaublich belastend, wenn man weiß, dass man eigentlich nichts in den Händen hat, was die Frau heilen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau Weihnachten erlebt, ist so gering, und sie kommt dann mit ihren kleinen Kindern täglich zur Behandlung. Das wäre ein Wunsch, dass man hier mehr Möglichkeiten hätte. Es wäre ein Ziel, mit allen Verfahren, die es gibt, Molekularbiologie, Strahlentherapie, Chirurgieverbesserung, irgendwann diesen Punkt zu erreichen, jedem Krebspatienten eine Heilungschance anzubieten. Damit man das Gefühl hat, die ganzen Anstrengungen haben sich gelohnt. Und es wäre sehr frustrierend, wenn man nach 30 Jahren im Beruf sagen müsste, man hat sich zwar angestrengt, aber es hat sich letztendlich nichts geändert.
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schlegel
Es hat sich doch schon einiges geändert, darum bin ich froh, aus der Kernphysik ausgestiegen zu sein, das war der weiseste Entschluss meines Lebens, denn die Forschungsarbeit in der Medizinischen Physik macht wirklich Spaß und auch die Tatsache, dass man mit relativ kleinen Dingen sehr viel bewegen kann, diese Erfahrung haben Physiker sonst eher selten. Das ist eine sehr befriedigende Sache. So wie beim Holzhacken, und wenn es nur das Spalten des Klotzes ist.
Sehen Sie noch die Einzelfälle? Den Erfolg am einzelnen Patienten?
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Jürgen Peter Debus
Ja, natürlich. Ohne das ist es auch gar nicht möglich. Daraus zieht man die Energie und die Motivation.



 Gebärdensprache
Gebärdensprache
 Leichte Sprache
Leichte Sprache