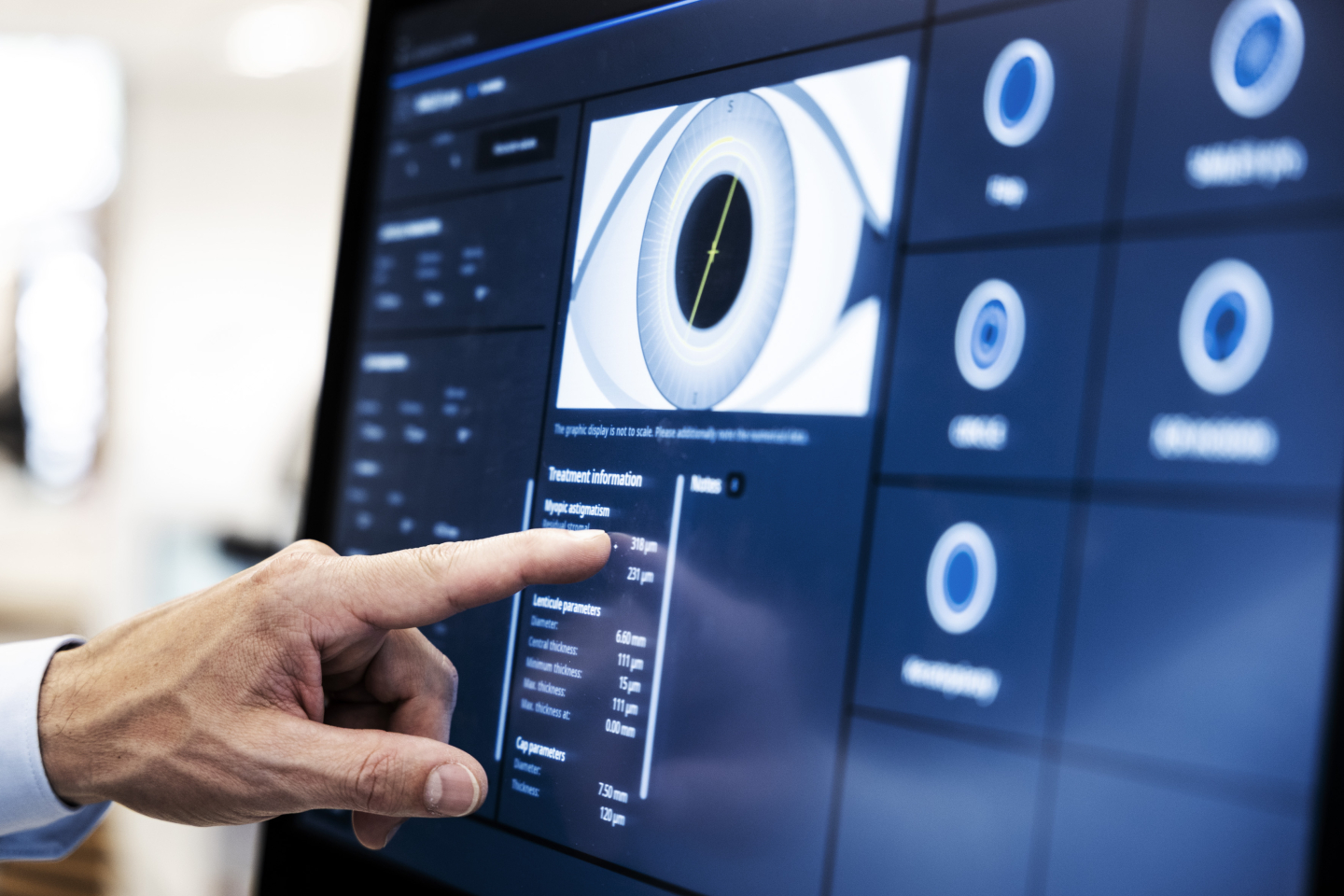Nominiert 2025
Sehkorrektur für Millionen Menschen

Im Idealfall ist unser Auge ein fein abgestimmtes optisches System, das mit Präzision funktioniert: Licht gelangt zunächst auf die Hornhaut des Auges, durchdringt dann die Linse und wird schließlich auf die Netzhaut projiziert. Dort wandeln die Sehzellen das Licht in Nervenimpulse um. Diese Impulse werden über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet, das die Informationen verarbeitet und in ein vollständiges Bild übersetzt. Stimmt die Geometrie des Auges nicht – weil der Augapfel etwa zu lang für die Krümmung der Hornhaut ist – entsteht ein unscharfes Bild. Brille oder Kontaktlinse gleichen das aus. Aber kann Fehlsichtigkeit auch minimalinvasiv und dauerhaft behoben werden?

Dr. rer. nat. Mark Bischoff, Dr. rer. nat. Gregor Stobrawa und Dipl.-Phys. Dirk Mühlhoff haben gemeinsam mit ihrem Team der Carl Zeiss Meditec AG genau das geschafft: Sie haben das minimalinvasive Verfahren der Lentikelextraktion und die dafür erforderliche hochpräzise Technologie entwickelt und damit die Augenlaserchirurgie revolutioniert.
Es erfüllt mich mit Stolz, zu wissen, dass wir die Augenlaserchirurgie revolutioniert haben und unzähligen Menschen zu besserem Sehen verhelfen konnten.
Dr. Mark Bischoff
Weitere Details
Lebensläufe
Dr. rer. nat. Mark Bischoff
23.03.1972
Geboren in Erfurt
1990 – 1995
Studium der Physik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Abschluss als Diplomphysiker, Schwerpunkt: Laserphysik1995 – 1999
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotionsstudent am Institut für Optik und Quantenelektronik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
2000
Promotion zum Doktor der Naturwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu Ultrakurzzeitspektroskopie an pflanzlichen Photorezeptor-Proteinen
2000 – 2001
Research Scientist in der Entwicklungsabteilung für Femtosekunden-Faserlaser bei IMRA America, Inc. in Ann Arbor, MI, USA
2001 – 2002
Wissenschaftler am Institut für Optik und Quantenelektronik der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Forschung zu einer laserbasierten Plasmaquelle für EUV-Strahlung
2002 – 2004
Entwickler im Projekt für die Entwicklung des Femtosekunden-Lasersystems VISUMAX und des Lentikelextraktionsverfahrens bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena
2004 – 2006
Projektleiter für die Entwicklung des Femtosekunden-Lasersystems VISUMAX und des Lentikelextraktionsverfahrens bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena
2006 – 2008
Leiter der Systementwicklung für Refraktive Laser bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena
2008 – 2016
Leiter der Forschung und Entwicklung für Refraktive Laser bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena
2016 – 2020
Leiter der Anwendungsforschung für Refraktive Laser bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena
Seit 2021
Leiter des Tissue-Engineering-Teams in der Forschungsabteilung der Carl Zeiss AG in Jena
Patente
Mehr als 500 veröffentlichte Patentanmeldungen in mehr als 70 Patentfamilien
Publikationen
12 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Fachbüchern
Dr. rer. nat. Gregor Stobrawa
16.08.1974
Geboren in Rudolstadt
1993 – 1998
Studium der Physik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Abschluss als Diplomphysiker, Schwerpunkt: Ultrakurzzeitspektroskopie1998 – 2003
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotionsstudent am Institut für Optik und Quantenelektronik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
2003
Promotion zum Doktor der Naturwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu Technik und Anwendung eines Impulsformers für ultrakurze Laserimpulse
2003 – 2004
Wissenschaftler am Institut für Optik und Quantenelektronik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
2004 – 2007
Entwickler im Projekt für die Entwicklung des Femtosekunden-Lasersystems VISUMAX und des Lentikelextraktionsverfahrens bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena
2007 – 2012
Projektleiter für die Entwicklung des Femtosekunden-Lasersystems VISUMAX und des Lentikelextraktionsverfahrens bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena
2012 – 2016
Leiter der Systementwicklung für Refraktive Laser bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena
2016 – 2023
Leiter des Entwicklungsprogramms für Refraktive Femtosekunden-Laser bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena
Seit 10/2023
Leiter der Workflow-Entwicklung für refraktive und therapeutische Behandlungen bei der Carl Zeiss Meditec AG, Jena
Patente
Mehr als 350 veröffentlichte Patentanmeldungen in mehr als 55 Patentfamilien
Publikationen
16 Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Fachbüchern
Dipl.-Phys. Dirk Mühlhoff
09.09.1970
Geboren in Gummersbach, NRW
1990 – 1996
Studium der Physik an der RWTH Aachen
Diplomarbeit am Fraunhofer Institut Lasertechnik;
Arbeitsgruppe Diodengepumpte Festkörperlaser
Abschluss: Diplom in Physik1996 – 2002
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Laborleiter für den Bereich Life Sciences
Carl Zeiss Jena GmbH, Forschungszentrum
Projekte u.a. in den Bereichen Laser-Scanning Ophthalmoskopie und Faserlaser2002 – 2010
Verschiedene Positionen im Bereich Forschung/Entwicklung
Carl Zeiss Meditec AG; Bereich Refraktive Chirurgie
Zunächst von 2002-2004 Projektleitung, später Leitung der Entwicklung;
Entwicklung des Femtosekunden-Laserkeratoms VISUMAX und des Behandlungsverfahrens SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)2007 – 2008
Berufsbegleitendes Studium an der Universität Augsburg
Abschluss: Master of Business Administration (MBA)2010 – 2025
Geschäftsfeldleiter Refraktive Chirurgie
Carl Zeiss Meditec AG
Zulassung und Vermarktung des laserchirurgischen Produktportfolios
Steuerung der klinischen und technologischen Weiterentwicklung u.a.
VISUMAX 800Seit 2025
Geschäftsführer MLase GmbH
Entwicklung und Herstellung medizinischer Excimer-Laser für Anwendungen in Ophthalmologie und Laser-Atherektomie
Weitere Tätigkeiten
2015 – 2025
AECOS American-European Congress of Ophthalmic Surgery
Member of the European Executive CommitteeSeit 2025
Allotex S.P.A.
Development of allogenic collagen implants for the correction of presbyopia
Member of Board of Directors
Patente
56 Patentfamilien aus den Bereichen Laser-Scanning-Ophthalmoskopie, Projektionstechnik und Refraktive Laserchirurgie
Kontakt
Koordination und Pressekontakt
Dr. Janine Luge-Winter
Carl Zeiss Meditec AG
Group Communications
Göschwitzerstrasse 51-52
07745 Jena, Germany
Tel: +49 (0) 364 / 12 20 335
E-Mail: janine.luge-winter@zeiss.com
Web: www.zeiss.com/med
Sprecher
Dr. Mark Bischoff
Carl Zeiss AG
Head of CRT-GT, Corporate Research and Technology
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena
Mobil: +49 (0) 151 / 16 77 43 56
E-Mail: mark.bischoff@zeiss.com
Web: www.zeiss.de
Beschreibung der Institute und Unternehmen zu ihren nominierten Projekten
Sehkorrektur für Millionen Menschen – ultrakurze Lichtimpulse ermöglichen minimal-invasives Augenlaserverfahren
Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan. Wir können damit Millionen von Farben1 unterscheiden und erkennen Dinge, die unglaublich weit weg sind, wie die Sterne am Nachthimmel oder winzige Details, wie die feinen Muster auf einem Schmetterlingsflügel. Gutes Sehen ist eine Voraussetzung für sicheres Bewegen in der Umwelt und ungehinderte soziale Interaktion. Doch intensives Lesen und Schreiben in Schule und Studium sowie kurze Sehdistanzen beim Umgang mit Smartphone, PC und TV führen in Kombination mit einer individuellen Veranlagung immer häufiger zu Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen weltweit. Die Korrektur der Fehlsichtigkeit mit Brillen oder Kontaktlinsen ist zwar üblich. Die Abhängigkeit von Sehhilfen kann jedoch auch als störend oder unangenehm empfunden werden – beispielsweise beim Arbeiten mit Schutzbrillen, beim Sport, bei Outdoor-Aktivitäten oder wenn man als älterer Mensch die Lesebrille nicht dabeihat.
Das Team um Dr. Mark Bischoff, Dr. Gregor Stobrawa und Dirk Mühlhoff hat ein Femtosekundenlaser-Keratom (VISUMAX®) entwickelt, das in der Augenhornhaut eines Menschen dreidimensionale Schnitte mit höchster Präzision und bisher unerreichter Geschwindigkeit erzeugt. Dieser medizinische Femtosekundenlaser ermöglicht das ebenfalls vom Team entwickelte chirurgische Verfahren der Lentikelextraktion (SMILE® Technologie), mit dem Augenchirurginnen und -chirurgen eine bestehende Fehlsichtigkeit2 minimal-invasiv korrigieren können.
Augenlaserkorrektur mit ultrakurzen Lichtimpulsen
Erste Ideen und Versuche zur chirurgischen Korrektur von Fehlsichtigkeit begannen bereits in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts und wurden mit der Verfügbarkeit von speziellen medizinischen Lasergeräten zu Beginn der 1990-er Jahre weltweit populär.3 Die Laser in-situ Keratomileusis (LASIK) gilt als das bekannteste Verfahren. Beim ersten Schritt dieser Augenlaserkorrektur wird mit einem chirurgischen Messer oder einem medizinischen Femtosekundenlaser ein sogenanntes „korneales Flap“ erzeugt. Dabei wird die oberste Schicht der Hornhaut, ähnlich einem Deckel (engl. Flap), teilweise gelöst, um anschließend mit einem medizintechnischen Excimerlaser die eigentliche Korrektur der Hornhautbrechkraft an dem darunter liegenden Gewebe durchführen zu können. Das Ziel des Entwicklerteams von ZEISS war es, ein weniger invasives Verfahren mit nur einem Augenlasergerät zu ermöglichen.
Das Entwicklerteam von ZEISS kombinierte hierzu einen Femtosekundenlaser mit einer speziellen Hochleistungsoptik und einer modernen Computersteuerung. Entsprechend der von Chirurginnen und Chirurgen festgelegten Parameter, berechnet und erzeugt das Medizingerät die für die Lentikelextraktion notwendigen Laserschnitte in der Augenhornhaut mit der erforderlichen Präzision: Pro Sekunde werden zwei Millionen ultrakurze Laserpulse (Dauer weniger als ein Millionstel einer Millionstel Sekunde) mit Mikrometergenauigkeit (1 Mikrometer = 1/1000-tel Millimeter) so in der Augenhornhaut positioniert, dass dort alle für das Verfahren erforderlichen Schnitte in weniger als 10 Sekunden erzeugt werden.
Um Bewegungen zu verhindern, wird bei dem Verfahren das Auge zunächst durch ein steriles Kontaktelement mechanisch mit dem Femtosekundenlaser von ZEISS verbunden. Mittels Laser wird dann ein Lentikel im Inneren der Augenhornhaut separiert und anschließend eine kleine Inzision erzeugt. Durch diese Inzision entnimmt die Chirurgin oder der Chirurg das Lentikel, wodurch sich die Krümmung der Vorderfläche der Augenhornhaut verändert und so die Fehlsichtigkeit behoben wird. Die nur wenige Millimeter breite Inzision schließt sich innerhalb weniger Stunden.
Schonende Sehkorrektur für Millionen Menschen
Jedes Jahr erreichen weltweit mehr als 50 Millionen Menschen mit korrekturbedürftiger Fehlsichtigkeit das Erwachsenenalter, womit das Wachstum ihrer Augen beendet ist. Ab diesem Zeitpunkt könnten die meisten von ihnen mit einem laserchirurgische Korrekturverfahren behandelt werden. Der wesentliche Grund, weshalb Menschen von einer laserchirurgischen Behandlung ihrer Fehlsichtigkeit absehen, ist die Sorge vor möglichen Komplikationen und Nebenwirkungen. Für die Lentikelextraktion mit einem Femtosekundenlaser von ZEISS belegen klinische Studien nicht nur eine sehr hohe Genauigkeit der Fehlsichtigkeitskorrektur. Bei dem minimal-invasiven Verfahren werden zudem nur sehr wenige der Nerven in der Augenhornhaut durchtrennt, wodurch die Nebenwirkung des „trockenen Auges“, die bei einem kornealen Flap auftreten können, deutlich reduziert werden. Zudem ist eine mögliche nachträglichen Verschiebung des Flaps durch mechanische Krafteinwirkung (z.B. Augenreiben, Schwimmen) praktisch ausgeschlossen.4,5 Die minimal-intensive Lentikelextraktion ist daher gerade für Berufsgruppen mit hohen Anforderungen an das Sehvermögen aber auch für Menschen mit großer sportlicher Aktivität besonders vorteilhaft.6
Das minimal-invasive Lentikelextraktionsverfahren mit einem Femtosekundenlaser von ZEISS wurde bei einem Menschen erstmals 2007 im Rahmen einer von der Carl Zeiss Meditec AG durchgeführten klinischen Studie in Deutschland realisiert.7 Im Jahr 2011 erfolgte die klinische Zulassung des Lentikelextraktionsverfahren (SMILE® Technologie mit VISUMAX®) in der Europäischen Union und im Jahr 2018 die Zulassung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA). In Europa ist die Lentikelextraktion mit der neusten Generation der Femtosekundenlaser von ZEISS seit 2024 auch für Menschen mit Weitsichtigkeit zugelassen – eine Patientengruppe, bei denen dieses minimal-invasive Behandlungsverfahren zuvor nicht anwendbar war. Weltweit haben Chirurginnen und Chirurgen bis heute mehr als 12 Millionen Augen mit den von ZEISS entwickelten Lentikelextraktionsverfahren und Femtosekundenlaser behandelt.
Über die Carl Zeiss Meditec AG
Die im MDAX und im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit 5.730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2023/24 (30. September) einen Umsatz von 2.066,1 Mio. Euro.
Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 39 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten.
Weitere Informationen unter: www.zeiss.de/med
[1] https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/how-humans-see-in-color#:~:text=They%20reflect%20wavelengths%20of%20light,up%20to%2010%20million%20colors.
[2] Myopie bis -10 Dioptrien als auch Hyperopie bis +6 Dioptrien, ohne und mit Astigmatismus bis -5 Dioptrien
[3] J. I. Barraquer, „Queratoplastia refractiva,“ Estudios e Informaciones Oftalmológicas, Bd. 10, pp. 2-21, 1949.
[4] H. Kobashi, K. Kamiya und K. Shimizu, „Dry Eye After Small Incision Lenticule Extraction and Femtosecond Laser-Assisted LASIK: Meta-Analysis,“ Cornea, Bd. 36, Nr. 1, pp. 85-91, 2016.
[5] A. H. Y. Wong, R. K. Y. Cheung, N. K. Wee, K. C. Shih, T. C. Y. Chan und K. H. Wan, „Dry Eye After SMILE,“ Asia Pac J Ophthalmol (Phila), Bd. 8, Nr. 5, pp. 397-405, 2019.
[6] R. K. Sia, D. S. Ryan, H. Beydoun, J. B. Eaddy, L. A. Logan, S. B. Rodgers und B. A. Rivers, „Visual outcomes after SMILE from the first-year experience at a U.S. military refractive surgery center and comparison with PRK and LASIK outcomes,“ J Cataract Refract Surg, Bd. 46, Nr. 7, pp. 995-1002, 2020.
[7] W. Sekundo, K. Kunert, C. Russmann, A. Gille, W. Bissmann, G. Stobrawa, M. Sticker, M. Bischoff und M. Blum, „First efficacy and safety study of femtosecond lenticule extraction for the correction of myopia: six-month results,“ J Cataract Refract Surg., Bd. 34, Nr. 9, pp. 1513-20, 2008.

 Gebärdensprache
Gebärdensprache
 Leichte Sprache
Leichte Sprache