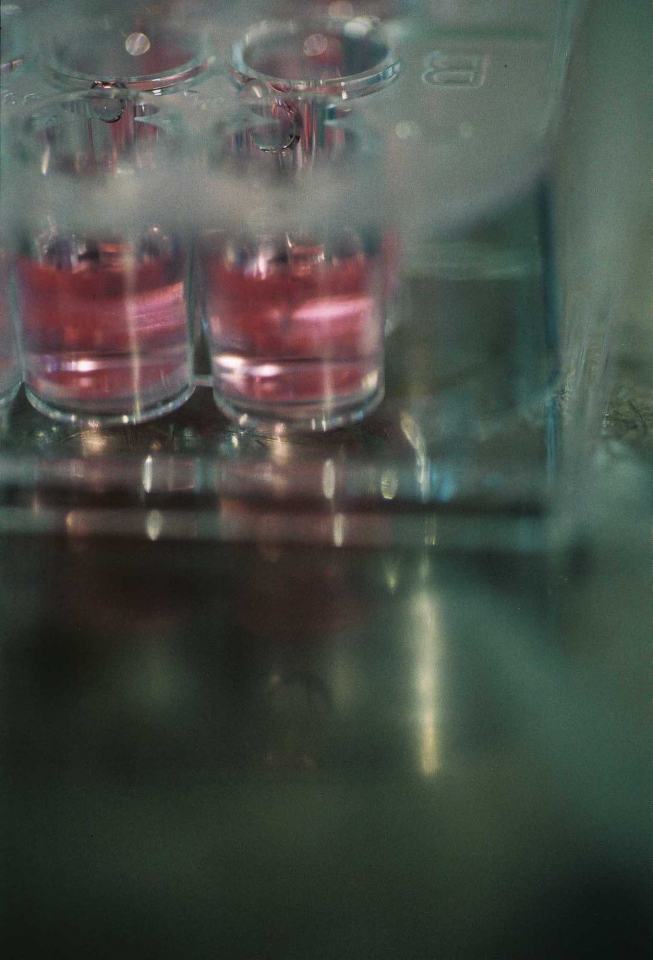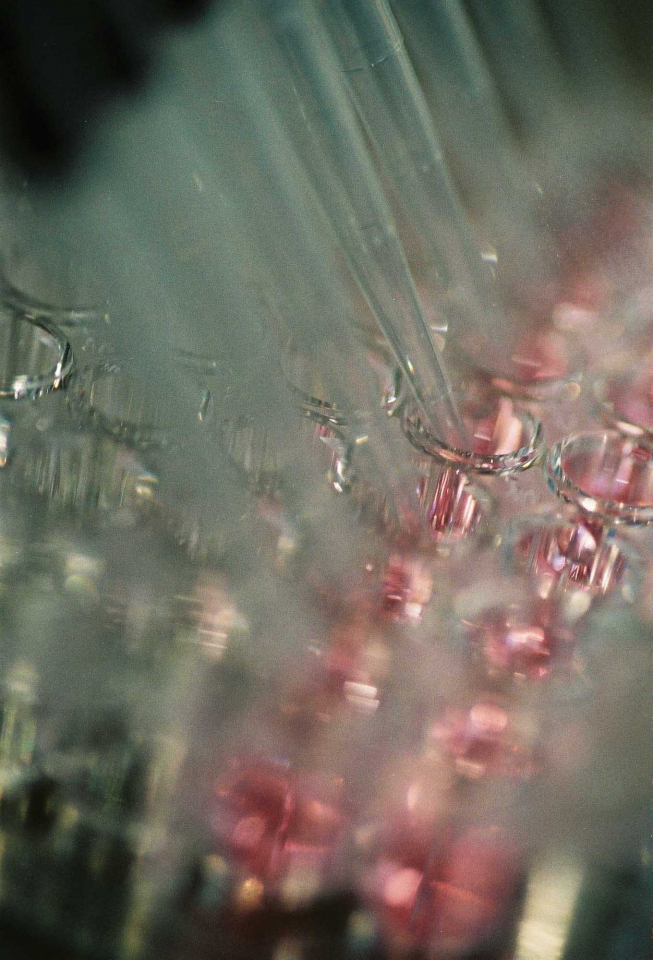Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Enzyme muss man zunächst als Katalysatoren verstehen. Das ist zwar auch ein Fremdwort, aber seitdem man in Deutschland Steuern sparen kann, wenn man einen Katalysator im Auto hat, ist es den meisten Menschen zumindest als Wort bekannt. Im Auto bewirkt ein Katalysator, dass die Restabgase soweit verbrannt werden, dass sie uns nicht mehr belästigen. Das wird erreicht, indem man an Edelmetallen eine Reaktionsbeschleunigung herbeiführt, so dass die Restgase schnell genug verbrennen, bevor sie aus dem Auspuff kommen. Katalysatoren sind also definiert als etwas, was eine Reaktion beschleunigt, aber unverbraucht aus der Reaktion wieder hervorgeht und sozusagen für eine neue Runde zur Verfügung steht. Das ist ein Geheimnis, das die Natur längst vor den Menschen erfunden hat. Es ist die Grundvoraussetzung, damit überhaupt Leben entstehen kann. Die Reaktionen, die zum Entstehen und Unterhalt unseres biologischen Lebens erforderlich sind, würden ohne Enzyme so langsam ablaufen, dass es nie ausreichen würde, um derart komplexe Gestalten wie Menschen, ja nicht einmal einen Einzeller, hervorzubringen. Die Natur hat komplexe Katalysatoren, die ihre Reaktionsabläufe erheblich beschleunigen - millionen-, zehnmillionenfach - und sie hat mit diesen Katalysatoren Strategien erfunden, die das Aufeinanderfolgen von Lebensvorgängen koordinieren, indem Aktivitäten angeschaltet, abgeschaltet, schneller, langsamer gemacht werden können, je nachdem wie man das Angebot an entsprechenden Reaktionspartnern, die umgesetzt werden wollen, wählt. Als Chemikerin habe ich schon früh im Studium etwas über Katalysatoren gelernt, und ich war fasziniert von Enzymen als Katalysatoren, weil sie anorganische Katalysatoren um Längen überragen. Es gibt ein paar Beispiele, wo man sie gegeneinander gemessen hat. Dabei waren Enzyme um den Faktor 100.000 bis eine Million Mal schneller. Aber sie sind nicht nur schneller, sie sind auch sehr viel spezifischer, so dass sie aus einer Vielzahl von angebotenen Substanzen nur eine Reaktion ausführen, mit einer Substanz und in einer ganz bestimmten Weise. Man kann z.B. Glucose in vielleicht hundert verschiedene Verbindungen umwandeln. Aber für den Zellprozess ist vielleicht nur eine gewollt und dieses Enzym macht nur diese eine. Das wird erreicht, weil Enzyme sehr präzise im Submikrobereich vorgeformte Oberflächen zur Verfügung stellen. Wenn man jemandem im Dunkeln eine Hand gibt, dann weiß man ohne nachzudenken, ob man die rechte oder die linke Hand bekommen hat. Das liegt daran, dass die räumliche Anordnung von Händen verschieden ist. Sie sind zwar gleich, haben vier Finger und einen Daumen, aber die räumliche Anordnung ist unterschiedlich und beinhaltet eine wesentliche Information. Das ist auch in der Zelle so. Deshalb müssen viele Dinge, die mit dem biologischen System interagieren - wenn wir schmecken, wenn wir riechen, viele Medikamente, Pflanzenschutzmittel etc. - eine bestimmte räumliche Anordnung haben. Nur mit der richtigen räumlichen Anordnung wird die gewünschte Reaktion auslöst. Das macht Enzyme gegenüber den anorganischen Katalysatoren - z.B. Edelmetallkatalysatoren, wie wir sie im Auto haben - wesentlich überlegen, weil die solche Möglichkeiten nicht haben. Das hat mich an den Enzymen immer sehr fasziniert und ich habe mir überlegt, dass man sie als technische Katalysatoren viel mehr nutzen sollte als bislang. Es gab bereits großtechnische Einsätze von Enzymen, aber das waren im Wesentlichen Sachen, die biologisch verfügbare Polymere, Stärke abbauen. Das ist außer für die Süßstoff-Industrie auch für die Papierindustrie wichtig. Wir bauen Proteine ab, dafür sind die Enzyme in unseren Waschmitteln, und wir bauen Zellulose in anderen Bereichen ab. Das ist vom energetischen Standpunkt und den milden Reaktionsbedingungen, die Enzyme haben, schon sehr vorteilhaft, aber interessant wird es in meinen Augen dann - das ist die Besonderheit -, wenn man chirale Moleküle, also solche, die eine eindeutige Raumerkennung haben, mit Enzymen produzieren kann. Dafür gab es noch keine technischen Beispiele und es fehlten bestimmte Voraussetzungen.
Wenn ich irgendjemandem erzählt habe, dass so was doch gehen müsste, hat der in den Katalog geschaut, und wenn man überhaupt Enzyme kaufen konnte, dann waren das, außer den wenigen die in der Technik benutzt wurden, Enzyme die in der Analytik eingesetzt wurden. Man hat mir dann sehr schnell vorgerechnet, dass das eine totgeborene Idee sei, weil sie als Katalysatoren viel zu teuer sind. Weil ich aber von der Idee nicht lassen wollte, habe ich zweigleisig gearbeitet, habe zuerst das Argument „Die kriegt man nicht, die sind zu teuer, die gibt es nicht“ in der Form aufgearbeitet, dass ich überhaupt neue Enzyme gesucht habe, dass ich vor allen Dingen Methoden erfunden habe, mit denen man in einfacher Weise Enzyme, die innerhalb der Zellen lokalisiert sind, isolieren kann; dies in einer Reinheit, dass sie für technische Zwecke einsetzbar sind. Dann waren sie auch sehr viel einfacher und billiger zugänglich als die Enzyme, die in der Analytik eingesetzt werden.
Die andere Voraussetzung ist, dass Enzyme häufig Koenzyme brauchen: Man muss für Reaktionen nicht nur den Katalysator beistellen, sondern braucht auch einen Hilfsstoff. Bis in die 80er und frühen 90er Jahre wurde noch in einschlägigen Lehrbüchern behauptet, koenzymabhängige Reduktionen, die eigentlich technisch sehr interessant sind, weil sie für viele Produkte die Voraussetzung schaffen, könne man nicht machen, weil die Koenzyme zu teuer sind. Dazu muss man wissen, dass das Enzym, das als Katalysator eingesetzt wird, im Reaktionszyklus immer wieder neu frei wird und man braucht es in ganz geringen Mengen. Das Koenzym braucht man Mol für Mol. Um ein Mol von Leucin zu produzieren, das hat ein Molgewicht von 131, brauche ich 665 Gramm NADH*, das ist die Kurzform für das Koenzym. Man braucht also 665 Gramm eines Hilfsstoffes, um 131 Gramm des Endproduktes zu erhalten. Dieser Hilfsstoff kostet mich über 50.000 Euro. Ihn nur rein Mol pro Mol einzusetzen ist wirklich abwegig. Man braucht also Bedingungen, in denen dieses Koenzym regeneriert wird. Während das Enzym arbeitet, um aus einer Ketocarbonsäure durch stereoselektive Anlagerung von Ammoniak eine Aminosäure zu machen, muss ich also das NADH regenerieren, damit es aus der wasserstoffverarmten Form wieder in die wasserstoffreiche Form übergeführt wird. Dafür gibt es verschiedenste Ansätze, die nicht effizient sind. Der Prozess musste in situ ablaufen. Insofern stellte sich die Frage, ob wir das nicht auch enzymatisch machen könnten. Wenn wir es enzymatisch machen, dann brauchen wir einen Wasserstoffträger, der entsprechend billig sein muss. Mir ist eines Tages die Idee gekommen, dass man mit der Formiatdehydrogenase (FDH) diese Reaktionen in einfacher Weise durchführen kann. Das ist ein Enzym, das ich kannte, das ich mal für jemanden, der sich für den Methanolstoffwechsel interessiert hat, isoliert und charakterisiert habe. Bei Boehringer habe ich mal gesehen, wie die NADH machten, mit ihrem damaligen Prozess. Das ist aber über 20 Jahre her, das müsste man eigentlich einfacher machen können. Mir ist dieses Enzym wieder eingefallen und wir haben es ausprobiert, und das ging. In Zusammenarbeit mit Herrn Wandrey habe ich die ersten auch kontinuierlichen Reaktionen durchgeführt und gezeigt: Es geht. Wir haben dazu einen Trick angewandt: Enzyme - die ja über hundert Mal größer als das Koenzym sind - kann man in einfacher Weise an einem hinreichend feinen Sieb, einer Membran, zurückhalten. Wir wollten jetzt einen möglichst kontinuierlichen Prozess haben, wo dieses Koenzym in seiner wasserstoffreichen und wasserstoffarmen Form möglichst schnell hin und her geht. Dafür braucht man eine Reaktion, die in Lösung abläuft. Um dem NADH nicht dauernd hinterher rennen zu müssen, versuchten wir es an ein wasserlösliches Polymer zu binden, dann hätte es artifiziell ein größeres Molgewicht und würde auch mit der Membran zurückgehalten. Und das hat funktioniert. Dann haben wir die ersten Reaktoren vorgestellt, die schon über Wochen, bis zu einem Monat und länger, kontinuierlich produzierten und dieses Prinzip verdeutlichten.
Das war aber anfangs noch nicht genug: Es gab ja dieses Enzym nicht zu kaufen und wir haben Prozesse entwickelt, wie man es in Millionen Einheiten - Enzyme werden immer in Einheiten gemessen - herstellen kann. Das hat die Firma Degussa, die schon von Anfang an Zutrauen zu unserem Reaktorkonzept hatte, aufgegriffen. Damit war also das NADH als kostenträchtiger Faktor abgehakt. Aber das Enzym war noch zu teuer. Also haben wir versucht, das Enzym noch billiger zu produzieren.
Die nächste Stufe für den wirklichen Fortschritt war, dass man das Enzym dadurch billiger macht, dass man seine Stabilität verbessert. Wenn ich den gleichen Preis bezahle, aber die zehnfache Menge Produkt damit herstellen kann, dann ist das eine effektive Kostenreduzierung um 90 Prozent. Deswegen sagte ich, dass es uns doch gelingen müsste, die Standzeit des Enzyms, die Verweilzeit, die Menge an Produkt, die man pro Enzym-Molekül fabrizieren kann, zu verlängern, indem man die Stabilität verbessert. Das war der Ansatz, mit dem Frau Pohl in die Entwicklung eingestiegen ist. Letztlich haben wir nicht nur die Stabilität um Faktor über 100 verbessert, sondern wir haben sogar aktivere Enzyme, als die Natur sie uns vorgegeben hat, die noch schneller funktionieren, gemacht.
Man sollte vielleicht noch dazu sagen: Die Formiatdehydrogenase erlaubt eine generische Technologie. Sie ist nicht nur für den Prozess, wie er bei Degussa zunächst realisiert wurde, interessant, sondern für jedweden Prozess, der Dehydrogenasen einsetzt und NADH als Koenzym benötigt. Insofern ist diese Arbeit über den eben beschriebenen Anwendungsfall hinaus von großer Bedeutung. Ich denke, dass sich auf dem Sektor noch mehr tun wird, bzw. schon tut.
Lassen Sie uns auf das Moment kommen, wo Sie gemerkt haben, dass es funktioniert.
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Die Innovation war sicher der Beweis, dass in situ Koenzymregenerierung machbar ist. Aber die technische Umsetzung erforderte außer der Innovation noch wesentlich mehr an Technik, die zum Teil noch nicht vorhanden war. In jedem Biochemielabor der Welt werden NADH-abhängige Reaktionen für die
Analytik gemacht. Das ist fast das erste, was die Studenten lernen. Aber das sind ganz andere Randbedingungen. Wenn ich einen Prozess darauf aufbaue, der im Endeffekt Tonnen des Endprodukts liefern soll, also wirtschaftlich sein muss, dann kann ich mir viele Dinge nicht mehr leisten. Da muss man dann eine Hürde nach der anderen nehmen. Zuerst wird gesagt: Das geht überhaupt nicht! Das kann man vergessen! Nun war ich schon als Kind leicht damit zu provozieren, wenn jemand gesagt hat, dafür bist du zu klein, oder das kannst du sowieso nicht. Ich glaube, dass der Augenblick der Innovation stattfand, als ich bei Boehringer den Prozess gesehen habe und mir gesagt habe, dass das, was die da machen, viel zu kompliziert und umständlich ist. Das muss man besser machen können. Ich habe mir in dem Augenblick schon vorgestellt, dass man das auch kontinuierlich machen könnte, dass man damit das technische Problem aus der Welt schafft. Auf der Heimfahrt vom Boehringer-Werk in Penzberg haben wir im Speisewagen auf einer Serviette skizziert, wie das aussehen könnte. Zum Durchsetzen jedoch war all das andere nötig: zu wissen wie man Enzyme in den großen Mengen auch in einfacher Weise gewinnt und die Erkenntnis, dass man mit vorhandenen technischen Mitteln das Enzym nicht mehr billiger machen kann. Da das Enzym inzwischen der teuerste Bestandteil des Prozesses ist, musste man versuchen, die intrinsischen Eigenschaften dieses Enzyms zu ändern. Diese Arbeiten haben irgendwann in den 80er Jahren Gestalt angenommen. Die ersten Überlegungen dazu stammen aus dem Ende der 70er Jahre, aber es gab noch nicht die Möglichkeiten, die wir später hatten, eben mit molekulargenetischen Methoden daran zu gehen. In dem Maße, wie das Problem konkretisiert wurde, wurden auch Techniken verfügbar, mit denen man das Problem angehen konnte, die wir nicht unbedingt selber erfinden mussten, sondern die wir nur clever einsetzen mussten.
Die technische Weiterführung wurde von Ihnen, Frau Dr. Pohl, übernommen?
Prof. Dr. rer. nat. Martina Pohl
Als ich das Thema übernommen habe, hatten wir es schon mit einem quasi stehenden industriellen Prozess zu tun, bei dem es Optimierungsbedarf gab. Das Enzym war zwar schon ganz gut, aber es zeigte sich während dieses Verfahrens, dass es immer wieder zu erheblichen Enzymverlusten kam. Man musste viel nachgeben, dementsprechend war die Wiederverwertbarkeit limitiert. Wir haben zunächst sehr intensiv beobachtet, was da eigentlich passiert. Das geschah immer im engen Kontakt mit dem Industriepartner. Wir haben das System bei der Degussa angeschaut, wir haben es teilweise hier im Labor nachgestellt und untersucht, weshalb das Enzym inaktiviert wird. Man sieht es makroskopisch daran, dass Formen wie Spaghettifäden entstehen, diese denaturierte Form kann man sehen. Wir haben die Parameter, unter denen das passiert, charakterisiert und festgestellt, dass es am pH-Wert, an der Temperatur, am Rühren, an Schwermetallspuren, die in den Lösungen enthalten sind und am Luft-Sauerstoff liegt. Das deutete alles sehr selektiv auf ein spezielles Problem und zwar auf eine bestimmte Aminosäure hin. Enzyme sind wie alle Proteine aus Aminosäuren aufgebaut. Eine spezielle Aminosäure hat eine Schwefelseitenkette, das ist Cystein, und dieser Schwefel ist explizit anfällig für all diese Parameter. Mit Hilfe einer Röntgenstruktur haben wir das Enzym dann untersucht. Man kann die Anordnung der einzelnen Aminosäuren mit Röntgenspektroskopie sichtbar machen und diese Daten dann computergrafisch visualisieren und so wie ein Raumschiff durch die Enzymwelt reisen und sich die einzelnen Positionen angucken. Wir wollten rausfinden, wo sich an der Oberfläche dieses Enzyms solche empfindlichen, schwefelhaltigen Seitenketten befinden. Wir haben diese Seitenkette tatsächlich gefunden, und wie die weiteren Untersuchungen zeigten, war es eine einzige, die relevant war; sie steht auffällig in die Lösung raus. Enzyme sind sehr kompakt: was innen ist, ist nicht so sehr gefährdet, aber alles was außen liegt, an Seitenketten, ist explizit anfällig für alles, was dem Enzym außen zustößt. Der nächste Schritt wäre gewesen, diese Aminosäure, die ja sehr reaktiv ist, auszutauschen gegen eine inerte, also nicht-reaktive Seitenkette. Das kann man nur mit gentechnischen Methoden. Mann kann nicht einfach die Proteinkette nehmen, auseinander schneiden und eine Aminosäure durch eine andere ersetzen, sondern man geht über den Bauplan der Zelle. Das setzt jetzt voraus, dass man diesen Bauplan, also sprich die DNA, auch kennt. Das war der erste Schritt, mit dem in einer Doktorarbeit begonnen wurde. Das war schon schwierig genug, nämlich die genetische Information aus dem Ursprungsorganismus rauszuholen. Das Enzym stammt aus einer Hefe mit dem schönen Namen Candida boidinii, da musste die richtige DNA gefunden werden. Wenn man die hat, kann man sie aus dem Ursprungsorganismus rausnehmen und in ein Bakterium hineinsetzen. Das Bakterium setzt die Erbinformation in ein Protein um und produziert analog zu diesem Bauplan das FDH-Enzym. Nun kann man dieses Bakterium mit der fremden DNA verwenden, um veränderte Varianten dieses Enzyms herzustellen. Diese Veränderungen führt man mit gentechnischen Methoden explizit in dieses Gen ein. Wir versuchten die Inaktivierung des Enzyms zu vermeiden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit an dieser Schwefelgruppe lag, indem wir den Bereich, der in der DNA für diese eine Aminosäure kodiert ist, austauschten. Das Ergebnis war durchschlagend, es passierte dankenswerterweise nichts, was nicht passieren sollte, sondern das Enzym wurde wie beabsichtigt stabiler. Das Verfahren ist patentiert und ist dann auch gleich durch die Firma Degussa genutzt worden. Unser Verfahren wird als „Rationales Protein Design“ bezeichnet, das heißt, man benutzt einen Rechner, man benutzt eine Struktur, man denkt sich vorher aus, was man machen will und dann macht man das, und wenn man Glück hat, klappt es auch noch.
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Dafür braucht man natürlich erhebliche Erfahrung und Kenntnisse dieses Enzyms.
Prof. Dr. rer. nat. Martina Pohl
Es gab viele Untersuchungen, die dahinter standen. Bei dem Aminosäurenaustausch kann es auch sehr gut passieren, dass das Enzym nicht mehr so arbeitet, wie es sollte, es aggregiert usw., damit muss man nicht unbedingt Glück haben. Diese Enzymklasse - es gibt mehrere FDH-Enzyme in unterschiedlichen Organismen - ist eigentlich, lapidar ausgedrückt, ziemlich lahm. D.h. ihre Wechselzahl ist recht gemächlich. Es gibt Enzyme, die sind um ein Hundertfaches schneller. Deshalb war unser nächstes Ziel: Ist es nicht machbar, dieses Enzym zu beschleunigen? Wenn es schneller wird, wird es wirtschaftlich noch interessanter, weil man weniger davon braucht. Die beiden Faktoren Stabilität und Schnelligkeit hätten die Super-FDH ergeben. Dafür haben wir ein moderneres Verfahren angewandt, denn mittlerweile hatte nicht nur die in die Chemie, sondern auch in die Molekularbiologie die Kombinatorik Einzug gehalten. Das Vorgehen ist nicht wie bisher: Wir dachten vorher ganz scharf nach, was wir da tun, machten dann genau eine Änderung und überprüften, ob es geklappt hat. Jetzt stellen wir zufällig eine riesige Bank veränderter Varianten her, wo wir gar nicht wissen, was wir da eigentlich verändert haben - wohlgemerkt immer in diesem kodierenden Abschnitt für die FDH - und dann suchen wir hinterher mit einer schlauen Methode die Verbesserten raus. Das Problem beim zweiten Verfahren ist erstens: Eine solch gigantische Masse an Mutanten zu durchmustern ist relativ arbeitsintensiv. Auf der anderen Seite muss man auch ein sehr intelligentes Suchsystem entwickeln. Hier braucht man dann wieder rationales Design. Wir haben mit der Hilfe eines Doktoranden ein System entwickelt, wie wir sehr schnell die Spreu vom Weizen trennen konnten. So mussten wir die aktivere FDH nur noch in einer sehr begrenzten, vorausgewählten Sortierung suchen. Wir haben sie gefunden, sie war knapp doppelt so aktiv wie die Vorherige. Berechnungen haben ergeben, dass es nicht mehr viel besser gehen kann, weil das System dann einer Diffusionslimitierung unterliegt, schneller kann es nicht mehr werden. Da ist die Grenze für das Enzym erreicht. Man wird es nicht noch zehnfach schneller machen können. Diese letzte Mutante enthält jetzt beides: Die stabilisierte Variante ohne Schwefelseitenkette und zusätzlich noch eine weitere Mutation, die das Ganze fast doppelt so schnell macht. An dem Punkt war eigentlich die Aufgabe erfüllt.
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Fast doppelt so schnell hört sich nicht besonders dramatisch an, aber es bedeutet: Man braucht nur die halbe Menge. Wenn ich vorher ein Kilo Enzym brauchte, dann brauche ich jetzt nur noch 500 Gramm. Das ist für diese Größenordnung wichtig. Es gibt Dehydrogenasen, die sehr viel schneller sind, das ist jedoch irrelevant, weil wir bereits an der Diffusionslimitierung angekommen sind. Da muss chemisch noch was anderes kommen, aber das ist im Augenblick noch nicht mal in Ansätzen erkennbar.
Ihre Leistung wurde schon hochgelobt als konsequente Umsetzung einer naturwissenschaftlichen Invention in technische Innovation. Ganz despektierlich gefragt: Was hat der normale Mensch davon?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Die Substanzen, die mit Hilfe dieser Enzyme erzeugt werden, finden Eingang in die Synthese von Pharmawirkstoffen. Auf dieser Grundlage sind im Augenblick Rheuma- und Aids-Mittel in der klinischen Erprobung. Darüber wissen unsere Industriekollegen viel besser Bescheid, weil diese Informationen selten öffentlich gemacht werden. Sie werden speziell als Bestandteil in Syntheseketten, bei denen wichtig ist, dass diese Gruppierung in einer stereoselektiven Form enthalten ist, genutzt.
Unsere Herstellung ist gegenüber einem chemischen Verfahren von geringerem Aufwand und ist damit eigentlich erst möglich geworden. Es gibt zwar eine chemische Synthese dafür, aber die ist außerordentlich aufwendig und keineswegs billig; wir haben keine Bedenken, dass die uns den Rang abläuft. Die Produkte selbst sind selten Endprodukte, sondern sie sind Zwischenprodukte, die die entscheidende geometrische Anordnung der Moleküle mitbringen, die nachher in Form von Medikamenten oder auch von Pflanzenschutzmitteln interessant werden kann.
In welchem Stadium der Anwendung sind Sie jetzt? Sind Sie bereits an einem Endpunkt angelangt oder haben Sie eine Basis geschaffen und es gibt andere Richtungen, in die Sie weiterentwickeln wollen?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Ich glaube, dass das erst der Anfang und keineswegs der Endpunkt ist. Das begründet sich einmal darauf, dass man mit dem Enzym Formiatdehydrogenase, das kostengünstig und in situ NADH regenerieren kann, viele andere Produkte, chirale Alkohole, Hydroxy-Säuren, ß-Hydroxysäureester usw. machen kann, und nicht nur reduktive Aminierung zu Aminosäuren. Es gibt solch eine Vielzahl von interessanten Produkten, die auch wegen der chiralen Eindeutigkeit speziell in der Pharma- und in der Agroindustrie eine Rolle spielen können. Aber es gibt auch durchaus Beispiele, wo solche Entwicklungen in der Duftstoffindustrie und der Lebensmittelindustrie wichtig sind. Aminosäuren können sehr unterschiedlichen Geschmack haben. Manche sind süß, andere sind sauer und das sind alles Rezeptoren, die interagieren und uns diese Eindrücke komplex vermitteln. Ich glaube, dass da noch vieles nachkommt. Man kann sich die Anwendung auch in anderen Formaten überlegen. Im Augenblick arbeiten wir mit löslichen Enzymen in einem Membranreaktor, in dem die Enzyme mit Hilfe einer Membran zurückgehalten werden. Da gibt es noch andere Varianten, zum Beispiel wenn man Verbindungen umsetzen will, die im Wasser schwer löslich sind. Da muss das Enzym dahingehend verbessert werden, dass es Lösungsmittel besser toleriert. Enzyme sind ja seit Milliarden Jahren für wässrige Umgebung in der Zelle optimiert. Man müsste ihnen antrainieren, ohne dass man ihre essenziellen Eigenschaften verändert, dass sie nun - bitteschön - auch noch Lösungsmittel aushalten müssen. Es gibt ein Anwendungsbeispiel in der Literatur, wo bei der Herstellung eines Pharmawirkstoffes nicht mehr die freien Enzyme benutzt werden, sondern die verbesserten Freiheitsgrade, die wir heute haben, ins Spiel kommen. Früher musste man mit dem Enzym, das einem von einem Organismus zur Verfügung gestellt wurde, arbeiten. Jetzt muss man nicht mehr mit so komplexen Organismen arbeiten, man kann die Information isolieren und sie auch in geschickter Weise kombinieren. Das sind alles Varianten über ein Thema, die jetzt zugänglich werden und die noch offen sind. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Man hat auch den Eindruck, dass Sie sich auf das Neuland, dass sich da noch was entwickelt, freuen.
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Ja. Die Natur liefert uns noch Tausende und Zehntausende weitere Enzyme, die man noch längst nicht ausgetestet hat. Man hat sich nicht einmal angeschaut, wie man chemisch katalysierte Routen durch biologisch katalysierte Routen ergänzen oder auch ersetzen könnte, die dann im Endeffekt umweltverträglicher und energieschonender arbeiten würden. Das wäre etwas für die Zukunft, das hier ist eine nachhaltige Technologie. Und wir bräuchten keine Metallkatalysatoren. Der Metallkatalysator im Auto hält zwar relativ lange, aber er muss auch immer wieder nachgeprüft und irgendwann recycelt werden. Und das sind noch recht einfache Katalysatoren. In der chemischen Industrie werden komplexe Metallverbindungen eingesetzt, um die größere Selektivität zu bringen. Ihre Herstellung ist ein riesiger chemischer Aufwand. Bei unseren biologischen Katalysatoren, die wir favorisieren, haben wir den Bauplan und wir müssen der Zelle Zucker und Ammoniumsalze geben und ein paar Spurenelemente zur Verfügung stellen und vielleicht noch irgendetwas, was die Zelle andreht, besonders viel von dem zu machen, was wir haben wollen. Dann macht die das. Heute, morgen und solange wir ihre genetische Information nicht verändern, macht die alle Tage dasselbe. Ich impfe den Fermenter an, und dann gehe ich nach Hause. Ich brauche keine vielstufige Synthese, wie für einen chemischen Katalysator. Das ist auch etwas, was immer übersehen wird. Die können ja schon ganz gut sein, aber sie sind noch längst nicht so gut wie unsere Enzyme und in ihre Herstellung geht unendlich viel Aufwand. Das funktioniert mit unseren Katalysatoren mit einem Lächeln. Wenn man sie erst mal hat.
Prof. Dr. rer. nat. Martina Pohl
Ich würde auch einen anderen Aspekt nicht vernachlässigen: Die Arbeiten hier haben wirklich gezeigt, dass es geht. Was lange selbst in Lehrbüchern als unmöglich für technische Anwendungen dargestellt wurde. Wir haben gezeigt, es funktioniert, und wenn es in diesem einen Fall funktioniert, ist es auch übertragbar. Ich denke, das wird eine Art Dominoeffekt auslösen. Die Degussa nutzt diese Verfahren jetzt gewinnbringend. Andere Wettbewerber sehen das ja auch. Auch solche, die noch auf Chemie eingeschworen sind. Sie werden auch darüber nachdenken, ob das nicht Alternativen sind. So dass dieses Dogma, was es ja lange Zeit gab - das ist alles viel zu teuer, viel zu kompliziert und geht sowieso gleich kaputt, geht nicht - dass das jetzt vom Tisch ist!
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Lange Zeit galten Enzyme als etwas sehr Esoterisches, was schon beim Hinschauen kaputtgeht und was ein normaler Chemiker möglichst nicht in die Hand nehmen sollte. Man muss diese ganzen Berührungsängste erst einmal abbauen und zeigen: Das ist ein Katalysator, nichts weiter. Auch ihre hochgezüchteten Katalysatoren, wie sie in chemischen Prozessen drin sind, zum Beispiel im Auto, kann man ganz leicht vergiften. Von den Enzymen sagt man, wenn man sie nicht sachgemäß behandelt, werden sie denaturiert. Die verlieren ihre notwendige dreidimensionale Struktur, die erforderlich ist, um den Job auszuführen. Ansonsten kann man sie ganz normal handhaben. Und man kann sie auch dahingehend trainieren, dass sie notfalls auch Lösungsmittel aushalten, was die Organiker bevorzugen.
Welches Team - außer Ihnen beiden - steht hinter dem Projekt?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Ich hatte hier am Institut vier Arbeitsgruppen und Frau Pohl war Arbeitsgruppenleiterin für die Leute, die sich speziell darum bemüht haben, Enzyme zu verbessern. Sie hat nicht nur über die Formiatdehydrogenase gearbeitet, wir haben auch andere koenzymabhängige Enzyme in Arbeit gehabt, bei denen ähnlich gute Erfolge erzielt wurden. Innerhalb der Arbeitsgruppe liefen viele Arbeiten mit Hilfe von Diplomanden, Doktoranden, studentischen Hilfskräften, auch technischen Mitarbeitern, die Routineuntersuchungen machten und die Methodik erarbeiteten. In den anderen Arbeitsgruppen war es ähnlich. Herr Dr. Hummel hat über die Jahre sehr viele andere Dehydrogenasen gefunden und charakterisiert, die mit der Formiatdehydrogenase zusammenarbeiten können. In einer anderen Gruppe befassen wir uns mit der Aufarbeitungstechnik, das ist ein spezielles eigenes großes Thema, aber es liefert die Voraussetzung, dass wir wahrscheinlich die einzigen in der Welt sind in einem akademischen Bereich, die nicht überfordert sind, wenn jemand eine Million Einheiten von einem Enzym zum Probieren haben will. Die FDH hat damals rund einen Euro pro Einheit gekostet. Sie wurde eigentlich nur als analytisches Hilfsmittel, deshalb oft nur in kleinen Mengen verwendet. Und wenn man sehr selektiv Ameisensäure neben Essigsäure und noch anderen Säuren in einem komplexen Lebensmittel nachweisen wollte, war das schon einen Euro wert.
Lassen Sie uns auf den Begriff der Innovation generell zurückkommen. Der ist viel genutzt und oft auch abgenutzt. Was ist Innovation für Sie?
Prof. Dr. Maria-Regina Kula
Ich unterscheide den Begriff der Erfindung von dem der Innovation. Die Erfindung ist eher darauf gerichtet, Wissen, das nicht bekannt ist, neu zu erarbeiten. Innovation ist die Idee, dass man mit dem, was man weiß, etwas anfangen kann. Ich glaube, das war sehr typisch von mir: Ich habe die Formiatdehydrogenase schon vorher gekannt, aber in ganz anderem Zusammenhang. Mir war, als wir sie isoliert haben, zunächst nicht bewusst, dass sie ein technisches oder wirtschaftliches Potenzial haben könnte. Erst als ich gesehen habe, wie bei der Herstellung von NADH für biochemische Zwecke ein Riesenaufstand betrieben wurde, habe ich mir gesagt: Das muss doch nicht sein. Dazu kamen noch andere Ideen, weil wir uns schon mit ähnlichen Problemen befasst hatten und wussten, dass man mit Hilfe von Enzymen chirale Produkte von einander trennen kann. Aber das ist eigentlich nicht das ganze Potenzial. Man müsste jetzt dazu übergehen, eine Substanz, die noch keine chirale Information hat, mit Hilfe von Enzymen in eine eindeutige chirale Form zu überführen. Die Reduktion und reduktive Aminierung von Carbonylverbindungen hätte das breiteste Anwendungsfeld. Wir hatten schon darüber nachgedacht, aber es gab noch keine zündende Idee im Hintergrund, wie man da rangehen kann. In dem Augenblick jedoch, als mir aufgegangen ist, dass die FDH alle Voraussetzung dafür erfüllt, sind diese Gedanken wieder hoch gekommen. Dann ist es nicht ein Einzelfall, für den man mit einem einzelnen Prozess eine relativ teure Substanz produziert. Da lässt sich zunächst in der chemischen Industrie niemand dafür begeistern. Weil ich das breitere Anwendungspotenzial sofort mit im Visier hatte, hat mich die FDH von Anfang an fasziniert. Deswegen habe ich immer das Durchhaltevermögen behalten, auch wenn es über schlafende Perioden ging. Immer noch mal dranzubleiben, zu sagen: Ja, warum macht er denn nicht und woran hakt es denn nun eigentlich? Und warum will er denn nicht? Die verschiedenen Argumentationsketten zu durchschauen und zu sagen: Ja, also wenn es dies nun ist und das nun ist, kann man es ändern, kann man es lösen, kann man es umgehen. Aber die Innovation geschah vorher. Das sind in meinen Augen immer drei Prozesse: Das Erfinden, das Erkennen, dass etwas nützlich ist - und das Erkennen alleine ist es nicht, man muss es dann auch umsetzen, und für das Umsetzen braucht man in vielen Fällen noch zusätzliche Technologie, die in der Fertigung, in der Herstellung von den chemischen Ausgangsstoffen, die man für einen Enzymprozess braucht, liegen kann. Bei uns lag der Vorteil im Wesentlichen darin, dass ich von der Katalysatorherstellung sehr viel mehr wusste als die meisten industriellen Kollegen.
Prof. Dr. rer. nat. Martina Pohl
Für mich kommt auf dem Weg von der Erfindung zur Innovation immer noch die praktische Umsetzung dazu, wie auch Frau Kula schon bemerkt hat. Sich etwas Schlaues auszudenken, was nützlich sein könnte, ist ganz sicher nur ein ganz kleiner Teil. Wir haben hier mit den Arbeiten gesehen, wie weit der Weg von der Erfindung bis zur wirklichen Innovation, also dem, was tauglich ist, was man anwenden kann, sein kann. Da sind eben ganz viele Rahmenbedingungen noch mit zu erfüllen. Innovation ist das, was letztlich wirklich umsetzbar ist, was fertig ist.
Eine Zielsetzung dieses Preises des Bundespräsidenten ist es, die Innovationen, Leistungen in Wissenschaft und Technologie in unserem Land vorzustellen und die Menschen, die das generieren. 2002 ist zum ersten Mal ein Frauenteam unter den Nominierten. Sie, Frau Prof. Kula, sind die erste Frau in Deutschland, die eine Großforschungseinrichtung geleitet hat. Sie sind in vielen Gremien vertreten. Wie haben Sie sich als Frau in einer männerorientierten Domäne durchgesetzt. Braucht man als Frau in naturwissenschaftlichen Berufen ein richtig dickes Fell?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Ich glaube, die Situation hat sich schon leicht verbessert, aber ich bin ja Jahrgang 37, meine Voraussetzungen waren sicher noch anders. Und in vielen Fällen brauchte man dafür Durchhaltevermögen, und man hatte immer den Eindruck, man muss eigentlich viel besser sein als alle männlichen Bewerber. Der Rest war nachher eine Frage des Humors. Ich habe z.B. als Geschäftsführerin der GBF (Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH) als wissenschaftliche Direktorin auch in den Gremien gesessen. Da hat Herr Beckurts uns einmal mit „Meine Herren…“ begrüßt. Da bin ich aufgestanden und habe gesagt: „Dann kann ich ja gehen!“. Ein anderes Mal habe ich einen Industrievertreter, der darüber berichtete, dass man mit der heutigen Zubereitung von den Proteasen in den Waschmitteln die Hände der Hausfrauen schont, gefragt, was das heißen soll, dass Männer nie waschen oder dass sie nicht geschont werden? Ich glaube, mit solchen Dingen kommt man viel weiter, wenn man das Ganze von der humorvollen Seite nimmt. Man braucht ein gewisses Maß an Schlagfertigkeit, um die Situationskomik ergreifen zu können, um auf dem Wege eine etwas andere Betrachtungsweise zu erzielen.
Man sagt heute, die Frauen kommen jetzt in vielen Berufen ganz stark, weil sie zum einen konsequenter und zum anderen kommunikativer sind. Ist das nachvollziehbar?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Kommunikativer kann sein. Konsequenter weiß ich nicht. Das ist, glaube ich sehr, sehr individuell. Mich hat sehr stark meine Kindheit geprägt, nicht so schnell aufzugeben und auch in vielen Parametern zu denken. Ich bin ein mittleres Kind und stamme aus einer Familie, in der der Vater im Krieg geblieben ist und die Mutter unter schwierigen Verhältnissen die Kinder aufgezogen hat. Da hat man eine ganz andere Einstellung zum Leben und zu dem, was man will. Als mittleres Kind muss man immer die Interessen vieler im Auge haben, und man ist von klein an darauf trainiert mit komplexen Dingen zu kombinieren und umzugehen. Ich glaube, dass der Rest sehr stark individuell geprägt ist.
Frau Dr. Pohl, was hat Sie bewogen, in den naturwissenschaftlichen Bereich zu gehen?
Prof. Dr. rer. nat. Martina Pohl
Wenn ich das rückwirkend betrachte, war eine sehr gute Chemielehrerin, die ich in der Schule hatte, der Auslöser dafür, dass ich tatsächlich Chemie studiert habe. Generell ist mir eine Begeisterung zu eigen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich denke, ich habe eine Forscherneigung, ich analysiere gerne Sachen und ich finde es auch gerne praktisch heraus. Das zusammen hat sicherlich die Begeisterung für die Naturwissenschaften ausgelöst.
Gab es - auf diesen weiblichen Aspekt bezogen - besondere Hindernisse in der Entwicklung Ihres Projektes, die ein Mann vielleicht nicht erfahren hätte?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Nein.
Frauen in naturwissenschaftlichen Berufen, Familie und Beruf, speziell hier, ist das zu vereinbaren? Als Argument dagegen wird oft die Länge der Ausbildung aufgeführt. Vorurteil - oder stimmt das noch?
Prof. Dr. rer. nat. Martina Pohl
Das stimmt mit Sicherheit noch. Ich denke, es gilt für alle Bereiche, in denen man nicht gut Teilzeit arbeiten kann. Jedenfalls dann, wenn man die traditionelle Rolle übernehmen muss, ist es schwierig, beides miteinander zu vereinbaren. Ich bin auch deswegen relativ unproblematisch durchgekommen, weil diesen Part mein Mann übernommen hat.
Was würden Sie jemandem empfehlen, der unentschlossen am Anfang seines Berufsweges steht und in einen naturwissenschaftlichen Beruf will?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Ich glaube, am Anfang sind die Vorstellungen alle nicht sehr nah an der Realität. Man sollte probieren, Dinge, die einen interessieren und die einem Spaß machen, auch von der realen Seite her kennen zu lernen. Heute gibt es die Möglichkeiten auch schon für Schüler. Ich empfehle den jungen Leuten, die mich fragen, zu überlegen, was ihnen wirklich Freude macht. Ob sie gerne mit Dingen oder ob sie lieber mit Menschen arbeiten, ob ihnen dieser Ansatz dann auch Freude macht. Ich glaube, dass man im Endeffekt nur mit Dingen erfolgreich ist, die einem auch Spaß machen. Ich sehe durchaus für mich persönlich, dass ich zu den ungeheuer privilegierten Personen gehört habe, wo alles zusammenfiel. Dass ich die Möglichkeiten hatte, meine Ideen auch umzusetzen, und dass ich selbstbestimmt arbeiten konnte, mir das raussuchen konnte, was mich interessiert hat. Gut, man muss immer Geld dafür besorgen, kann vielleicht nicht alles auf einmal tun und nicht so schnell, wie man es gerne hätte, aber im Wesentlichen eben doch selbstbestimmt zu arbeiten, diese Positionen sind hinreichend selten. In dem Maße, in dem ich älter geworden bin, habe ich schon gemerkt, dass das eine sehr privilegierte Position ist. Aber ich glaube, wichtig ist das Interesse an der Sache und ein gewisses Maß an Freude, an die Dinge heran zu gehen. Die größere Schwierigkeit ist vermutlich, festzustellen, was einem diese Freude macht, sich bei diesem ungeheuren Angebot auf irgendetwas festzulegen.
Gewisse Begabungen sind sicher auch von Vorteil. Keiner würde einen künstlerischen Beruf ergreifen, der nicht eine entsprechende Begabung dafür hat. Auch im Naturwissenschaftlichen sind neben Interesse auch bestimmte Herangehensweisen, eben analytisches und logisches Denken, ein gewisses Maß an Gedächtnisleistung usw. die Voraussetzung, um erfolgreich zu werden. Man sollte versuchen herauszufinden, was man gut kann und das mit den Dingen kombinieren, die einem Spaß machen, die einen wirklich interessieren. Aber das ist nicht immer leicht.
Frau Dr. Pohl, Sie erwähnten eine Lehrerin, die Ihnen das Naturwissenschaftliche vermittelt hat. Solche Impulse sind wichtig. Wird derzeit in den Schulen zu wenig Lobbying für Naturwissenschaften betrieben?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Die Studentenzahlen belegen das. Ich glaube, dass in vielen Fällen die Anforderungen im Studium den Studenten in naturwissenschaftlichen Fächern zunächst höher erscheinen, als in den „weicheren“ Fächern. Sie sind im Endeffekt, meiner Ansicht nach, nicht höher, aber sie treten früher ein. In naturwissenschaftlichen und technischen Fächern muss man sehr viel früher Zwischenprüfungen und laufend Klausuren schreiben und Wissen nachweisen. Das kommt bei jemandem, der beispielsweise Soziologie studiert, erst nach dem vierten Semester oder am Ende des Studiums, bis dahin haben sie noch nicht gemerkt, wie gut sie sind.
Gibt es ein Motto oder eine formulierbare Motivation für das, was Sie tun?
Prof. Dr. rer. nat. Martina Pohl
Nichts ist unmöglich.
Wie schätzen Sie das Klima für Forschung oder Innovation im weitesten Sinne in Deutschland ein und wie stehen wir im internationalen Vergleich da?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Wir waren in Deutschland lange Zeit wissenschaftlich führend in unserem Bereich, jedoch was die Umsetzung betrifft am Ende der Skala. Das hat damit zu tun, dass sich in Deutschland die Diskussion über die Gentechnik zu lange an den möglichen Gefahren bestimmter Dinge festgehalten, die Chancen, die dieses Vorgehen bietet, zu wenig beachtet hat. Erst durch die Ausschreibung des BioRegioWettbewerbs ist stärker ins Bewusstsein gekommen, dass die Technik in unkontrollierter Weise gegebenenfalls Risiken beinhaltet, dass es aber sehr viele Möglichkeiten gibt, sie gefahrlos für Mensch und Umwelt zu benutzen. Die kostengünstige Herstellung von Enzymen ist heute daran gekoppelt, dass man solche Methoden einsetzt. Wenn die Enzyme hinterher gereinigt werden, ist an ihnen überhaupt kein Erbmaterial mehr nachweisbar, d.h. damit ist auch die Gefahr eliminiert. In den Produkten, die wir damit machen, ist solches Material noch nie drin gewesen. Es ist auch so, dass wir Katalysatoren brauchen, die für den technischen Einsatz noch besser angepasst sind. Dafür sind sie in der Natur schlichtweg nicht vorbereitet. Wir schalten eine forcierte Evolution im Reagenzglas nach, um solche Varianten zu finden, die dann unter diesen Umständen besser angepasst sind, die stabiler und noch ein bisschen schneller sind. Das ist nur mit gentechnischen Methoden machbar. Das geht überhaupt nicht anders. Erst seit diese Vorurteile etwas abgebaut sind, kommen wir zu einer rationaleren Behandlung der Gentechnik und können die Stufen, auf denen sie gefahrlos einsetzbar ist und uns Vorteile bietet, von den Stufen unterscheiden, auf denen man mit entsprechend viel Vorsicht an die Dinge herangehen muss. Das war einer der Punkte, die sehr wesentlich waren und die uns in der Innovation lange behindert haben. Der Rest ist im Augenblick natürlich die Finanzierung. Das Bundesministerium hat über Projekte sowohl uns wie auch den Partnern Risikokapital zur Verfügung gestellt. Aber jetzt sind das Börsenklima und die Finanzlage der meisten Firmen nicht gut, so dass sich dort aus rein finanztechnischen Randbedingungen das Innovationsklima im Augenblick vermutlich wieder verschlechtert. Aber das sind Dinge, die zunächst von der Technik losgelöst zu betrachten sind, denn die Fluktuation an der Börse hat sehr selten etwas mit dem technischen Potenzial der handelnden Personen oder Firmen zu tun. Leider. Früher war das anders, das war also noch sehr viel näher am Technischen, Machbaren, am Fortschritt gemessen, aber das hat sich jetzt leider verändert.
Hatten Sie im Verlauf des Projektes immer das Gefühl, dass Sie genügend Unterstützung hatten? Hätten Sie Wünsche an die Öffentlichkeit, an die Gesellschaft und hätten Sie mehr Unterstützung gebraucht?
Prof. Dr. rer. nat. Martina Pohl
An die Unterstützung der Gesellschaft habe ich eigentlich nie gedacht…
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Doch, die Unterstützung der Gesellschaft fehlte gerade im Zusammenhang mit der Gentechnik. Das war schon deutlich. Wir sind auf dem Gelände des Forschungszentrums zunächst aus gemieteten Räumen in die neuen Labors umgezogen und was das für einen bürokratischen Aufwand bedeutet, um die gentechnische Erlaubnis wieder zu bekommen, ist unglaublich. Da wäre uns eine etwas realistische Einschätzung der Dinge schon etwas angebrachter erschienen. Man muss doch relativ viel Zeit und Energie und auch Geld unnötigerweise in Dinge stecken, die eigentlich nicht angemessen sind. Ich muss nicht auf irgendetwas, von dem ich nur einen Milliliter handhabe, mit einer Kanone drauf zielen. Diese differenzierte Betrachtungsweise über Gefahr an sich und Gefahr konkret ist inzwischen besser geworden, die ganzen Vorschriften haben sich ja auch geändert, aber es war zum Teil schon sehr hemmend.
Wenn Sie noch mal die Wahl hätten, würden Sie Ihren Lebens- und Berufsweg wieder so sehen oder hätten Sie etwas anders machen wollen?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Nein, generell nicht. Es gibt sicher manche Entscheidungen, bei denen man sich sagt, da hättest du eher drauf kommen können, oder da hättest du besser die Finger davon gelassen, aber generell gesehen habe ich es nie bereut und bin damit grundsätzlich zufrieden. Ich glaube, dass ich mit der Studienentscheidung instinktiv eine Wahl getroffen habe, die meine Möglichkeiten, Fähigkeiten und meine Interessen optimal kombiniert. Dazwischen habe ich eigentlich sehr viel Glück gehabt. Das ist der Vorteil meiner frühen Geburt, dass diese Karriere überhaupt nicht geplant war, sondern sich als die Summe von Zufällen ergeben hat. Wichtig ist das Nutzen der gegebenen Chance. Das war eines der Dinge, die ich Frau Pohl, als sie sich zum ersten Mal bei mir vorgestellt hat, sagte: Mobilisieren Sie Ihre Hilfskräfte! Sie können zwar alles lernen, aber Sie kommen schneller zum Ziel, wenn Sie Freunde und Kollegen, Hilfstruppen mobilisieren können, die Ihnen helfen, und nutzen Sie Ihre Chance. Ich habe meinen Leuten immer sehr viel Freiheit gelassen, weil ich in meinem eigenen Studiengang als essenziell empfunden habe, dass mir meine Vorgesetzten sehr viel Freiheit ließen, in dem, was ich an Lösungswegen oder an Vorschlägen eingebracht habe, und dass man selbst auch seine Hilfstruppen optimal organisiert und einsetzt. In dem Zusammenhang möchte ich auch noch erwähnen, dass ich über viele Jahrzehnte mit Herrn Wandrey sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe. Er hat praktisch mit unseren Katalysatoren die Reaktionstechnik, die optimalen Bedingungen, unter denen man sie zur Geltung bringen kann, erforscht. Wir haben viel zusammen gemacht. Das ist ein gutes Beispiel für die Organisation von Hilfstruppen. Ich hätte das im Prinzip auch alleine gewusst und gekonnt, aber die waren viel besser und hatten alles in den Fingerspitzen, was ich wieder aus einem Buch hätte lernen müssen, nachdem ich 15 Jahre keine technische Chemie mehr angeschaut hatte. Es ist sehr wichtig, dass man ein Arbeitsumfeld hat, in dem man spezielle Dinge, die für den Erfolg gebraucht werden, die man aber selbst nicht in dem notwendigen Ausmaß beherrscht, in Kollaboration lösen kann, und in dem Fall war es eben vielfach Herr Wandrey. Die Zusammenarbeit ist mehr als die Summe des Einzelnen und das ist wichtig.
Mit was entspannen Sie sich denn eigentlich und was gibt es noch außerhalb des Projektes?
Prof. Dr. rer. nat. Martina Pohl
Wenn Sie jetzt auf Hobbies anspielen: Ich lese viel, ich laufe, ich fahre Rad. Und wenn es mich ganz überkommt, und wenn ich die Zeit dazu habe, dann mache ich Seidenmalerei.
Und wie ist es bei Ihnen, Frau Prof. Kula, gibt es überhaupt noch außerhalb der Projekte und des Institutsbetriebes etwas für Sie?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Ja, ja. Alle meine Leute wissen, dass ich im Sommer für drei bis fünf Wochen absolut unauffindbar bin, weil ich dann in Norwegen Langstreckenwanderungen mache und weder ein Handy noch sonst etwas dabei habe, sondern nur über ein Rentier erreichbar bin.
Sie sind einfach weg?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Ich bin weg, ja. Die Doktoranden hat es gelegentlich genervt: Ich bin schon zwei Mal mit dem Hubschrauber nach Hause gekommen, aber es hält mich trotzdem nichts davon ab. Ich brauche diese Art von Erholung und Einsamkeit, um mich von dem normalen Stress zu erholen, funktionsfähig zu bleiben. Ansonsten fotografiere ich gerne Blumen, nach Möglichkeit auch seltene Blumen. Das ist so ähnlich wie beim Pilze-Suchen: Das Finden ist die Hauptsache, da laufe ich auch schon mal lange dafür rum und probiere, und wenn man es hinterher noch mit einem schönen Bild belegen kann, dann ist das der Lohn.
Was ist Glück für Sie und was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Prof. Dr. rer. nat. Maria-Regina Kula
Glück ist für mich, mit mir selbst und auch mit der Welt im Reinen zu sein. Und für die Zukunft hoffe ich, dass vieles von dem, was ich ausgesät habe, Frucht bringt, hier oder dort oder anderswo und dass ich selbst noch so lange gesund und aufnahmefähig bleibe, um es noch ein bisschen genießen zu können.
Dr. Martina Pohl
Ich würde fast ähnlich antworten. Glück ist, das innere Gleichgewicht zu haben, das bedingt auch alle äußeren Faktoren, und wenn die nicht stimmen, hat man das innere Gleichgewicht auch nicht. Was ich mir für die Zukunft wünsche ist, dass ich noch ganz viele spannende Dinge lerne, auch in meinem weiteren beruflichen Werdegang und dass ich und meine Familie gesund bleiben.
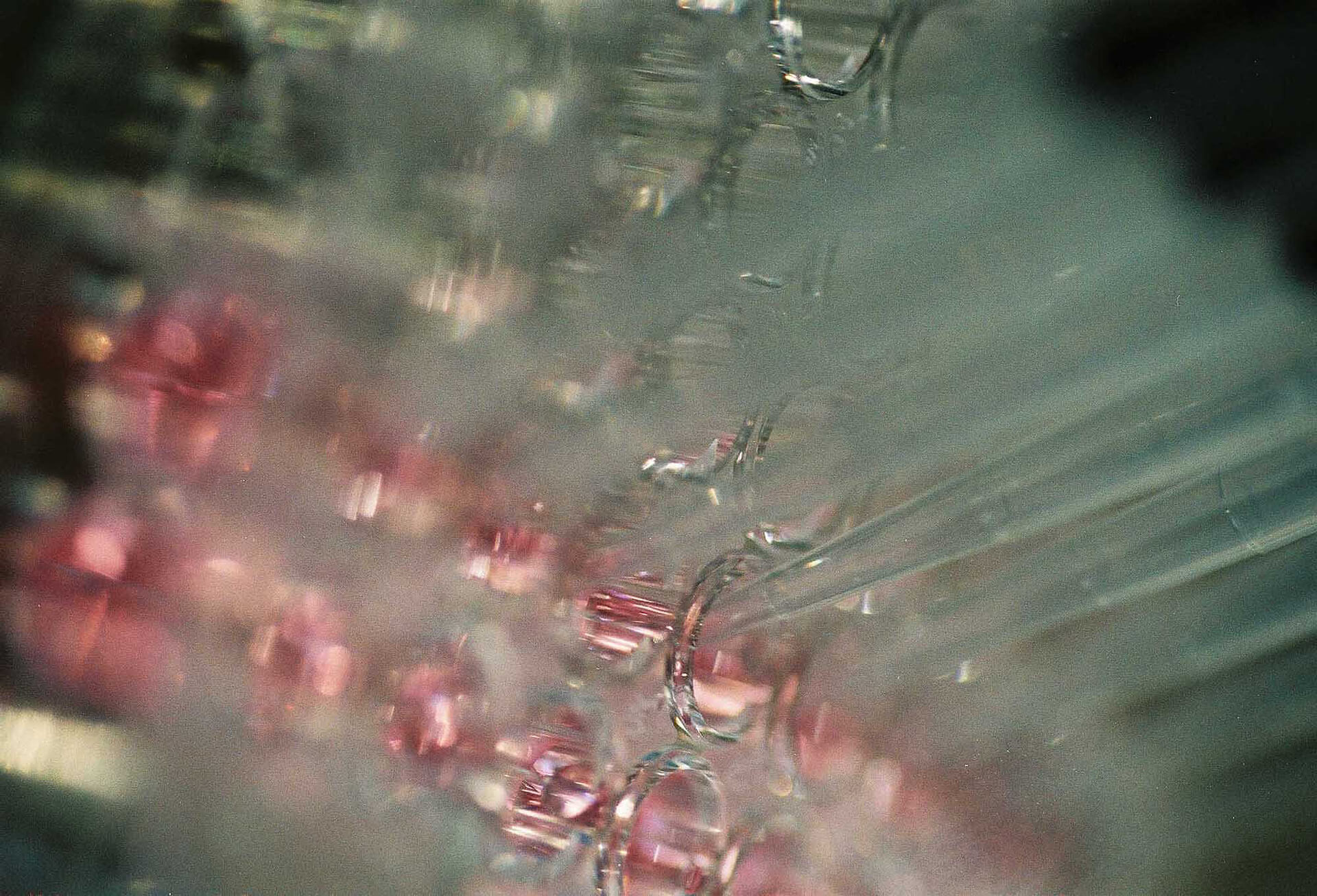




 Gebärdensprache
Gebärdensprache
 Leichte Sprache
Leichte Sprache