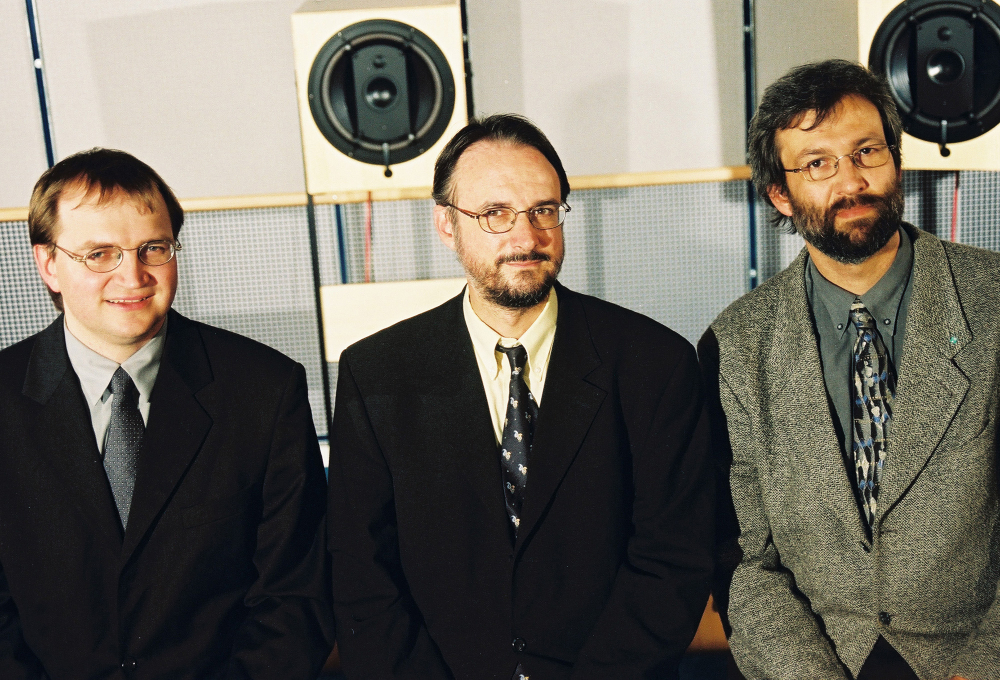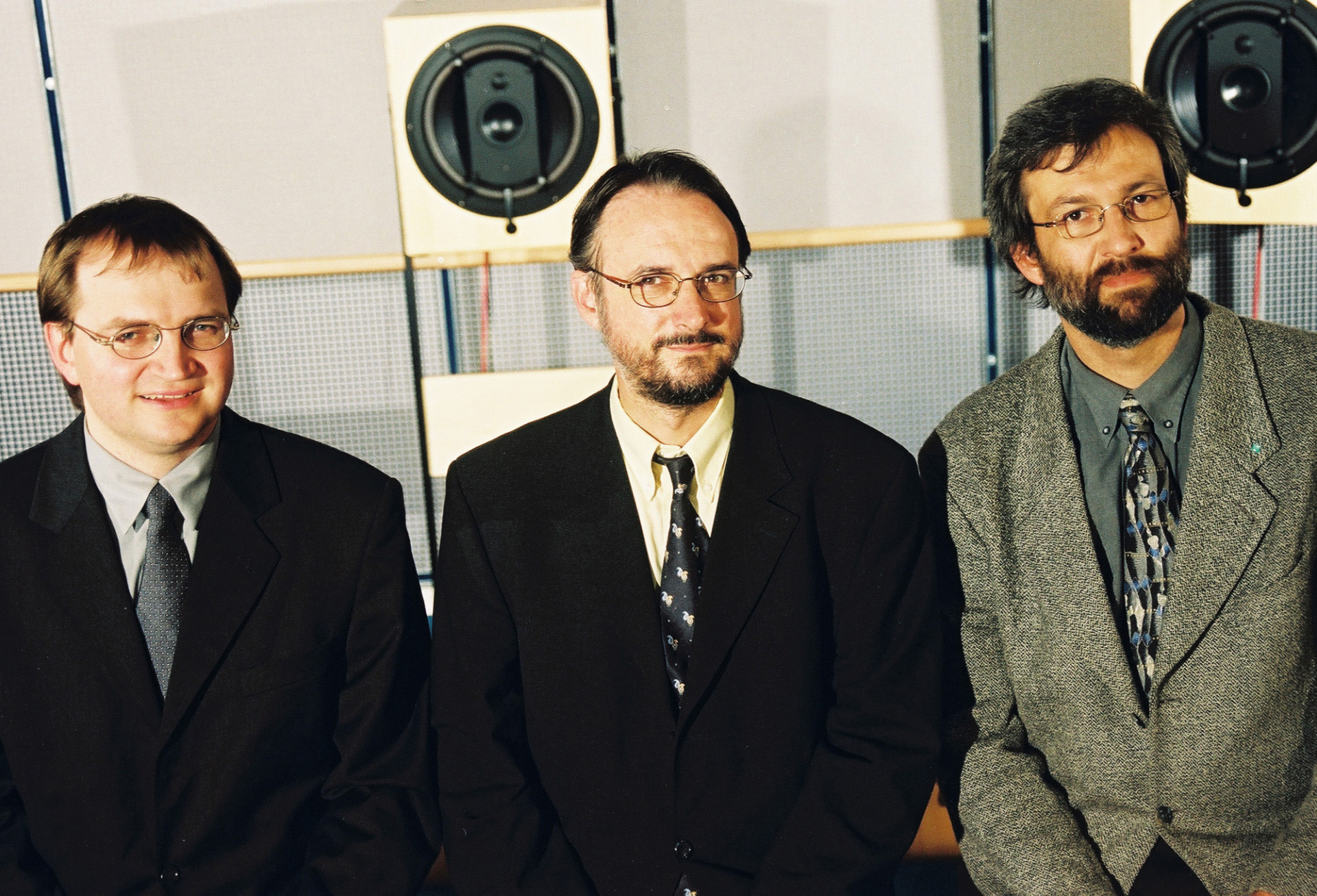Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Ich denke, es war eine Mischung aus beidem. An bestimmten Stellen verlief die Entwicklung in Stufen, es fielen Entscheidungen, die das Projekt deutlich vorangetrieben haben. Gleichzeitig gab es auch eine langwierige Vorgeschichte oder einen Entwicklungsprozess, es haben ja auch viele verschiedene Personen an dem Projekt mitgewirkt.
Die Vorgeschichte beginnt mit meinem Doktorvater Professor Seitzer, der sich bereits in den siebziger Jahren mit der Idee beschäftigt hat, Musik zu komprimieren, um sie zum Beispiel über ISDN übertragen zu können. Daraufhin folgen drei Entwicklungsstufen. Zum einen die Grundlagenforschung im wesentlichen an der Universität, aber auch schon zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, zum zweiten die Standardisierung, in der man bereits gemeinsame Wege ging. Der dritte Bereich war die Durchsetzung auf dem Markt. Es waren jedoch noch viele weitere Schritte erforderlich, denn mit dem Erreichen des internationalen Standards begann die Arbeit erst richtig.
Was ist in den einzelnen Entwicklungsstufen passiert?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Der erste Teil war die Forschung an der Universität und später zusammen mit dem Fraunhofer-Institut: Anfang 1986 war zu einem Forschungsprojekt zum Thema Audiocodierung ein Bericht fällig. Eine Woche später kam mir der berühmte „Geistesblitz“, dass man das Projekt auch ganz anders angehen könnte. Nach einer Woche sehr harter Arbeit hatte ich nachgewiesen, dass die Idee prinzipiell funktionierte.
Das war ein deutlicher Schritt vorwärts, nach dem die eigentliche Arbeit begann. Die Idee ist eine Sache, aber deren Umsetzung eine andere. In jahrelanger Arbeit musste das Projekt in der Simulation am Rechner verfeinert werden.
Parallel dazu lief die Arbeit zum digitalen Rundfunk an, bei der die Herren Popp und Grill dazustießen. Herr Grill hat zu dieser Zeit seine Diplomarbeit geschrieben, in der er die erste Realisierung für ein Gerät erprobt hat. Dabei stieß er auf Dinge, die vorher noch nicht richtig funktioniert hatten. Er hat das Projekt damit einen weiteren Schritt voran gebracht. Mit der Komprimierung von 64 Kilobit war im Frühjahr 1988 ein erstes Traumziel erreicht.
Dipl.-Ing. Harald Popp
Ein weiterer Schritt in der Entwicklung fand 1987 statt, als das Fraunhofer-Institut die Programmtexte von der Universität erhielt, der die Audiocodierung schon auf einem relativ hohen Niveau gelungen war. Die Entwicklung an den Computern der Universität war zu dieser Zeit jedoch sehr mühsam.
War das noch Grundlagenforschung?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Im Prinzip waren das schon Anwendungen. 1987 begannen die Forschungen für Digital Audio Broadcasting (DAB). Es gab verschiedene Teams, die an der Kompression von Audiosignalen für DAB gearbeitet haben.
Dipl.-Ing. Harald Popp
Es war angewandte Forschung.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Es war eine Mischung. Man hat, um etwas für die Anwendung zu schaffen, an den Grundlagen weitergearbeitet.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Es ist bis heute der Fall, dass man sich in einigen Fällen immer wieder mit den Grundlagen beschäftigen und Messungen oder Experimente durchführen muss, die in der Literatur nicht detailliert genug beschrieben sind.
Sie gehen immer wieder auf die Grundlagen zurück und aktualisieren Ihre Ergebnisse?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Das ist richtig. Zum Beispiel enthält das Projekt ein wesentliches Element, das aus der Anfangszeit stammt und eher eine zufällige Erfindung war. Wir fanden heraus, dass bei diesem Verfahren ein Format standardisiert wird und die Encoder weiter entwickelt werden können. Somit kann man bessere Kompressionsverfahren entwickeln, die alle mit demselben Format arbeiten.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Anders ausgedrückt, der Empfänger ist festgelegt, aber man kann den Sender noch lange nach dieser Festlegung verbessern, wodurch wir auch nach der Standardisierung von MP3 gewaltige Fortschritte erzielen konnten.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Das klingt heute selbstverständlich, war jedoch für die damalige Zeit ein großer Schritt.
Dipl.-Ing. Harald Popp
Die Neuheit des neuen Standards war, dass man die Möglichkeit hatte, noch in der Zukunft Verbesserungen einbauen zu können.
Wann verliefen die einzelnen Entwicklungsstufen?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Von 1986 bis 1989 wurde im wesentlichen Grundlagenforschung betrieben. Die zweite Phase, die Standardisierung, begann Ende 1988 mit MPEG Audio. Die Entwicklung verlief weiter in zwei Stufen bis 1992 bzw. 1994, wobei wir später an Nachfolgeverfahren mitgearbeitet haben.
MP3 besteht in seiner heutigen Form seit 1994.
Es gab also richtiggehende Zäsuren in der Entwicklung?
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Ab einem gewissen Punkt muss man ein Format festlegen und ist damit nicht mehr richtig frei. Natürlich gab es auch eine Wettbewerbssituation.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Wie ich bereits erwähnt habe, haben an der DAB-Entwicklung verschiedene Teams mitgearbeitet. Zu bestimmten Zeiten haben wir uns sogar eine Art „innerbayerisches Wettrennen“ geliefert, weil es zwei Konsortien gab. Wir hatten eine strategische Zusammenarbeit mit AT&T, wo ich 1989 und 1990 in den USA gearbeitet habe. Im ersten Konsortium hatten wir außer AT&T noch Thomson Consumer Electronics als Partner, die bereits Anfang der Achtziger Jahre Arbeiten zur Audiocodierung an der Universität Duisburg gefördert und einiges zur Grundlagenforschung beigetragen hatten. Dieses Konsortium haben wir in gewissem Sinn geführt, weil die Hardware, die im Test war, hier programmiert wurde.
Das andere Konsortium bestand aus dem Institut für Rundfunktechnik, Philips, CCETT und Matsushita.
In der Standardisierung wurden verschiedene Modi, Layer 1, Layer 2 und Layer 3, definiert.
Layer 2 war identisch mit dem Vorschlag des Instituts für Rundfunktechnik, Philips und CCETT. Layer 3 hatten wir zusammen mit AT&T und Thomson erarbeitet und wurde dann den anderen Ergebnissen angepasst. Layer 2 war weniger komplex, dafür bei den niedrigen bit-Raten nicht so effizient. Layer 3 besaß eine effizientere Codierung bezüglich eines hohen Kompressionsfaktors, aber hatte damals den Ruf, zu komplex zu sein.
Dipl.-Ing. Harald Popp
Wir wurden mit der Kritik konfrontiert, dass wir zwar einen hervorragenden Beitrag geleistet hätten, aber der Markt sich bereits entschieden hätte und für unser Projekt nicht mehr aufnahmefähig wäre.
Diese Kritik hat uns beflügelt, weil wir der Meinung waren, ein gutes Verfahren entwickelt zu haben, dass es wert war, der Welt präsentiert zu werden.
Sie haben sich mit dem Projekt aus der Grundlagenforschung über die Standardisierung heraus immer mehr in die wirtschaftliche Umsetzung begeben. Wie hat sich dieser Prozeß entwickelt und wie sehen Sie grundsätzlich die Chancen einer Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Die Zusammenarbeit war über die Jahre hinweg unterschiedlich ausgeprägt. In den ersten Jahren waren wir Außenseiter, was dazu geführt hat, dass es zwar bestimmte kleine Firmen gab, die gerne mit uns zusammengearbeitet haben. Für die größeren Firmen in Deutschland waren wir Exoten, die man nicht beachten muß.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Die Technik war zwar auch von den großen Firmen anerkannt, aber der Kostenfaktor war damals noch höher als ein paar Jahre später. Zwei bis drei Jahre später war er kein Thema mehr.
Wie setzte und setzt sich das Team zusammen, das am Projekt/Produkt gearbeitet hat, wie hat sich hier die „Verlagerung“ von Wissenschaft zur Wirtschaft bemerkbar gemacht?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Zum einen ist die Gruppe an der Universität zu nennen. Zunächst war ich alleine als wissenschaftlicher Mitarbeiter, später gab es Diplomanden und weitere Mitarbeiter. Weitere Namen aus der Anfangszeit sind Dr. Sporer, Professor Seitzer und Professor Gerhäuser. Letzterer hat von Anfang an ganz stark auf diese Technik gesetzt und als Teamleiter und verantwortlicher Abteilungsleiter bei Fraunhofer wesentlich mitgeholfen, das Projekt voranzutreiben.
Dipl.-Ing. Harald Popp
Weiterhin sollte man auch Ernst Eberlein erwähnen, der als Softwareentwickler für Signalprozessoren tätig war, außerdem Jürgen Herre, der durch seine wissenschaftlichen Beiträge das Projekt stark unterstützt hat.
Das waren die Keimzellen der Teams, um die sich dann Hardwaredesigner und Softwareentwickler für die Entwicklung der Signalprozessoren gebildet haben.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
1989/1990 gab es bereits acht bis neun Leute, die an dem Projekt gearbeitet haben. Die Programme wurden im wesentlichen von drei Leuten geschrieben: Ernst Eberlein, Bernhard Grill und Jürgen Herre. Die Hardwarekonzeption, Aufbau und Tests wurden u. a. von Harald Popp, Stefan Krägeloh und Ernst Eberlein durchgeführt.
Dipl.-Ing. Harald Popp
Der erste Grund für das gute Teamwork war sicherlich der gegenseitige Vorteil, der für beide Seiten zu verspüren war. Der Vorteil für die universitäre Forschung bestand im Zugriff auf die Praxis. Für das Fraunhofer-Institut lag der Vorteil in dem hervorragenden Verfahren und wiederum im Zugriff auf die universitäre Forschung, die das Institut selbst nicht hätte leisten können. Es war ein gegenseitiges Gewinnspiel und hat allein deswegen gut funktioniert.
Zum Zweiten haben sich die Leute gut verstanden.
Drittens wurden wir zusammengeschweißt nach dem Motto „wir gegen den Rest der Welt“. Wir hatten zwar das beste Verfahren, aber noch nicht den Durchbruch in den Massenmarkt geschafft.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Wir haben zunächst bewusst auf den Profi-Markt gesetzt, auf dem solche Geräte teure Telefon-Mietleitungen ersetzen und sich so z.B. für Rundfunkanstalten innerhalb weniger Monate amortisieren können.
Die erste Serie haben wir in Prototypen gebaut und einzeln verkauft, bis wir Hersteller gefunden hatten. Das Fraunhofer-Institut baut ja an sich keine Geräte…
Dipl.-Ing. Harald Popp
Regelmäßig gab es den „Elfenbeinturm-Vorwurf“ nach dem Motto: „Ihr Akademiker habt da etwas Schönes gemacht…“
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
„… ihr habt ein sehr gutes Verfahren gebaut, aber man kann es nirgendwo einsetzen…“
Dipl.-Ing. Harald Popp
Uns war wichtig, den Nachweis zu erbringen, dass man das tatsächlich kaufen kann und keineswegs zu astronomischen Summen.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Wichtig war das Engagement des Teams, das nie den Glauben an seine Entwicklung verloren hat. Außerdem haben wir nach und nach die richtigen Schritte unternommen.
Die öffentliche Förderung wie in den Jahren 87 bis 93 war ausgelaufen. Dann ging es um das Überleben.
Weitere Entwicklungen haben wir aus den Einnahmen aus dem Profibereich finanzieren können, andere haben uns geholfen und es wurden jedes Jahr weitere Anwendungen entwickelt: 1994 der Decoder-Chip der Firma Intermetall, dessen Entwicklung Martin Dietz am IIS maßgeblich mitgetragen hat. Im Januar 1995 entstand der Kontakt mit World Space, die ersten Software-Player benutzten unsere Entwicklung. Auch die Entscheidung, das Internet zum Marketing zu benutzen, war hilfreich.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Man musste nicht mehr etwas Teures kaufen. Die normalen PCs, die jeder zu Hause hat, wurden schnell genug, um unser Verfahren decodieren zu können, d. h. jeder konnte unsere Software benutzen.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Wir haben bewusst das Internet für das Marketing benutzt mit FAQ, mit der Web-Site, mit Shareware, indem wir Programme mit eingeschränkter Funktionalität zum Ausprobieren ins Netz gestellt haben, den Win-Play gab es als Demoversion.
Dann kamen ungeplante Ereignisse dazu: Die Demoversion wurde gehackt und war dann, wenn auch illegal, doch kostenlos weit verbreitet. 1997 wurde ein Windows-Encoder mit einer gestohlenen Kreditkartennummer von einer kleinen Firma, mit der wir zusammenarbeiten, gekauft, das User-Interface wurde verändert, ein Read-me-File wurde dazu geschrieben: „Dies ist Freeware, danke an Fraunhofer.“ Das Produkt, das eigentlich für ein paar hundert Dollar pro Exemplar verkauft werden sollte, hat sich in Windeseile illegal über das Netz verbreitet.
Welche Hindernisse und Probleme gab es bei der Realisation des Projektes über die relativ lange Zeitschiene, die Sie jetzt miterlebt haben?
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Technische Schwierigkeiten: In der ersten Runde hatten wir die beste Technik, die aber aufwendig zu realisieren war. Es gab den Kompromiss, die beiden Verfahren einander anzunähern, so dass man die Layer 1, 2 und 3 im Standard hatte. Das hieß für uns, sich auf die andere Technik zuzubewegen. Die Konkurrenz war hier im Haus und hat testgehört, es klang - zwei Tage vor Abgabetermin - schrecklich. Die anderen zogen siegessicher ab.
Der Grund waren fehlerhafte Werkzeuge, dadurch wurden die weniger wichtigen Bits durcheinander gewürfelt, was den Klang erheblich beeinträchtigt hat. Hätten wir das nicht ganz kurz vor dem Verifikationstest herausgefunden, hätte hier das Ende sein können.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Probleme: Wir haben ohne uns der Tragweite bewusst zu sein immer wieder Dinge richtig gemacht, wo wir ansonsten in große Schwierigkeiten hätten kommen können. Wir haben darauf geachtet, dass wir keinesfalls unlizenzierte Musik verteilen, dass geistiges Eigentum zu achten ist, uns öffentlich immer auf die Seite der Künstler, Autoren und Musikindustrie gestellt.
Auch mit der RIAA (Recording Industry Association of America) habe ich von mir aus Kontakt aufgenommen, was uns Sympathie gebracht hat.
Haben Sie Wünsche oder Forderungen an die Gesellschaft, die Politik, wenn es darum geht, Projekte wie Ihres zu realisieren?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Es gab relativ früh absehbare Schwierigkeiten mit Kopierschutz und Organisation des Musikvertriebs. Sowohl von Seiten der Musikindustrie wie auch von der Politik wurden wir nicht ernst genommen, bis einige wegen der möglichen Folgen in Panik gerieten.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Die Geschwindigkeit der Veränderungen hat beide überrascht: Die etablierte Industrie und die Politik.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Dass Geräte wie die MP3-Player vor dem Jahr 2000 auf den Markt kommen würden, war einigen bereits 1995 klar.
Waren die Fördermittel ausreichend, haben Sie Zugang dazu gehabt?
Dr.-Ing. Bernhard Grill
In der Anfangszeit über das DAB ja. Die Förderung war ausreichend, und es gab Anschlussfinanzierungen. Später haben wir immer reinvestiert. Wir sind gut gestellt, wir können aus Lizenz- und Projekteinnahmen neue Forschungen betreiben. Bedenklich ist, dass seit 3 bis 4 Jahren die Förderung dieser Bereiche von Seiten des Bundes komplett ausgetrocknet ist. Unser Anteil an öffentlichen Projektmitteln ist - abgesehen von der Grundfinanzierung der Fraunhofer-Gesellschaft von vormals 40 bis 50% - auf nahezu Null zurückgegangen.
Wie hat sich der Prozess der Lizenzierung und die Erlangung der Patente abgespielt? Konkret: Was hatten Sie davon?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Unter Internetbedingungen so etwas wie MP3 zu lizenzieren, dafür gab es keine Vorbilder. Insofern wurde auch dieser Vorgang mit entwickelt und wir mussten uns ständig anpassen. Die erste Regel ist, flexibel zu sein und die Ohren am Markt zu haben. Kürzlich wurde ich gefragt, wie wir unsere Lizenzsätze setzen. Meine Antwort war: Wir sehen uns an, auf welches Geschäft die Firma zielt, und suchen dementsprechend einen Satz, der für beide Seiten fair ist. Einen Satz, der uns einen Anteil am Gewinn sichert und es der Firma erlaubt, das Geschäft zu realisieren.
MP3 wird von Thomson Multimedia lizenziert. Die Entwicklung der Lizenzmodelle war ein gemeinsamer Prozess. Ich habe schon Amerikaner sagen gehört, wir seien diejenigen, die weltweit am meisten vom Lizenzsystem im Internet verständen.
Man braucht klassische diplomatische Fähigkeiten und muss hinter das Pokerface schauen können, in dem Geschäft kann man alles Mögliche erleben.
Der I & K Markt, zu dem Ihr Projekt - besser gesagt das Produkt - zuzurechnen ist, ist das Wachstumspotential der Zukunft. Welche Rolle spielen wir in diesem Markt und wie stehen wir im internationalen Vergleich da?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Wir haben gezeigt, dass es geht, andere können das auch. Inzwischen ist es kein Problem mehr, in Deutschland Wagniskapital zu erhalten. Vergleicht man die kleinen Firmen in Deutschland mit denen in den USA, stellt man einen Mentalitätsunterschied fest, der die Deutschen behindert. Die Amerikaner haben mehr dieses Entrepreneurtum, gehen aber trotzdem sorgsamer vor. In Deutschland gibt es ähnlich unternehmerisch Denkende, die aber auf einmal die Grundrechenarten vergessen und fast pleite gehen.
In der Kultur gibt es Unterschiede. In der Technik, beim Zugang zu den Märkten, gibt es die Chancen für deutsche Firmen. Ich denke, es wird nicht so bleiben, dass es fast keine deutsche Unterhaltungselektronik-Industrie gibt. Je weiter wir in die Zukunft schauen, desto mehr sind die Gehirne das Notwendige, nicht das billigste Arbeitskraftangebot oder entsprechende Steuersätze. Gehirne sind das Wesentliche und da sieht es in Deutschland gut aus.
Was macht Europa? Gibt es analoge Entwicklungen?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Es gibt ähnliche Firmen in Holland, Großbritannien und Frankreich, weniger, aber auch in Spanien, Portugal, Italien.
Eine neue Studie der Universität Leipzig behauptet, nur Europa und Amerika würden zukünftig in diesem Markt eine Rolle spielen, nicht Asien.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Das sehen wir ganz anders. Wir haben Kontakte nach Japan, wir hatten frühzeitig viele Fans in Korea, dort ist der Win-Play sehr verbreitet. China wird sich anschließen, auch dort ist der Win-Play sehr bekannt.
Das Internet ist durch seine rasante Entwicklung gekennzeichnet. Was ist die Lebensdauer dessen, worüber wir heute reden?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
In den Lizenzverhandlungen 1997 mit Microsoft hat man mir bereits gesagt, AAC (Advanced Audio Coding, von ISO 1997 unter wesentlicher Beteiligung von Fraunhofer IIS-A standardisiertes Audiocodierverfahren der zweiten Generation) sei schon im Kommen, für die alte Technologie bekämen wir nicht mehr viel. Ich habe damals nicht widersprochen.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Wir haben an der Technik weiter gearbeitet. MP3 ist die erste Generation, 1997 ist die zweite Generation standardisiert worden, was im Moment aus verschiedenen Gründen nicht so bekannt ist. Wir dachten, die erste Generation weicht dem Neuen. Damit lagen wir daneben, die Lawine war im Rollen. Die neue Hardware-Generation, die jetzt in den Laboren ist, wird auf jeden Fall kommen.
Von den Decoder-Chips, die sich jetzt in den Playern befinden, waren bis Ende 1999 insgesamt 2,5 Millionen lizenziert; die Schätzungen sagen, dass etwa 1 Million Geräte weltweit verkauft wurden. Zum Ende des ersten Quartals 2000 hatte sich die Zahl der lizenzierten Chips verdoppelt. Die Schätzungen für dieses Jahr - weniger für die Abspieler, da die Flash-Memories noch zu teuer sind, sondern für CD-Spieler, die auch MP3 abspielen können, und MP3-Zusätze in verschiedenen Geräten, z.B. Autoradios - gehen zum Teil in Richtung zwölf Millionen Stück. Pläne von Firmen wie den Halbleiterherstellern ermutigen uns zu einer Schätzung von einigen zehn Millionen Stück im Jahr 2001. Dass die MP3-Funktionalität in zukünftigen Geräten erhalten bleibt, ist wegen der großen Verbreitung sehr wahrscheinlich. Ich denke, es wird noch über etliche Jahre verwendet werden.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Die Technik kommt für die vielen Musiker, die ihre Musik anderen zugänglich machen wollen aber keinen Plattenvertrag haben, wie gerufen. Sie können ihre Musik im privaten Kreis verteilen, ins Netz stellen, vielleicht mit Firmen wie e-music Einnahmen erzielen. Da ist eine kleine neue Musikindustrie entstanden. Auch professionelle Musiker setzten MP3 ein, um Demo-Tapes auszutauschen. Es ist ein Werkzeug, das den einfachen Austausch von Musik über das Internet ermöglicht. Das fängt gerade richtig an.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Inzwischern recherchieren die Plattenfirmen, ob sie den nächsten großen Hit im Internet finden. Das ist bisher noch nicht passiert, aber das wäre der Durchbruch für die Electronic Music Distribution.
Damit sind wir bei der aktuellen Situation: MP3 und das Urheberrecht. Umreißen Sie bitte kurz Ihre Position!
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Fraunhofer arbeitet ja selbst mit geistigem Eigentum. Wir sind selbstverständlich der Meinung, dass Denkarbeit, ob sie sich in Form von Programmen, Musik oder Texten äußert, entlohnt werden sollte. Es gibt die Philosophie, dass alles, was gedacht wird, frei für alle sein sollte; dieser Meinung bin ich nicht. Es ist schön, wenn Leute sich das finanziell leisten können, aber ich denke, geistige Leistungen sollten auch entlohnt werden. Da sind wir ganz auf der Seite der Musiker, der Rechteorganisationen und der Musikindustrie. Privat bin ich kein Freund von Napster, und es ist richtig, dass sie vor Gericht angegriffen werden.
Um geistigen Diebstahl zu vermeiden, arbeiten wir seit 5 bis 6 Jahren mit einigem Aufwand an Alternativsystemen mit Kopierschutz. Wir sind Gründungsmitglied von SDMI.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Die Plattenindustrie sagt, wir liefern die Werkzeuge für das Raubkopieren. Die Internet-Philosophie heißt „alles umsonst“, und jetzt wirft man Fraunhofer vor, abkassieren zu wollen.
Wir wollen denjenigen, der seine Musik frei verteilen will, nicht behindern, das sollte immer noch möglich sein. Allerdings haben wir nicht unter Kontrolle, wie die Plattenindustrie ihr Eigentum schützt, auch wenn wir versuchen, Methoden zu schaffen, die einen Schutz ermöglichen.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Elektronischer Vertrieb von Musik bietet viele Chancen. Zum einen wird das legal zugängliche Angebot größer. Mehr Leute haben die Chance, ihr spezielles Interesse zu befriedigen, der Markt weitet sich aus, Musik wird bequemer erhältlich sein. In Zukunft kann man mit der Musik Signaturen übertragen, so dass erkennbar ist, was gespielt wird. Das ist im Moment ein Problem. Man hört Musik z.B. im Radio, sie gefällt, aber man kennt den Interpreten nicht. Folglich gestaltet sich ein eventueller Kauf schwierig. Mit einem geeigneten System könnte ich einen Knopf an der Stereoanlage, am Palm oder am MP3-Player drücken, die Signatur würde mitgehört. Von meinem Computer bekomme ich später die Information, welche Aufnahme ich gehört habe und ich kann sie unmittelbar noch einmal anhören bzw. unmittelbar kaufen. Es gibt viele Möglichkeiten, Musik besser zu vermarkten mit diesen Methoden.
Es gibt neue Methoden und technische Entwicklungen für den Musikvertrieb, die im Moment von den Firmen entwickelt werden. Stichwort Digital Rights Management, Super Distribution. Es gibt Firmen, die solche Techniken einsetzen wollen. Die Musikindustrie sagt bis jetzt, wir machen einen Test hier und da. Aber es gibt noch kein wirklich großes Angebot in diesem Sinne. Natürlich dauert ein Download auch über ISDN noch sehr lange. Kinder, die im Augenblick Musik am Computer machen, ein Jukebox-System haben, haben nur die Wahl zwischen illegalem Download oder nichts. Dann entscheiden sie sich für den illegalen Weg.
Die Vorwürfe gebe ich inzwischen zurück: Was habt ihr getan, warum schlaft ihr seit fünf Jahren und schlaft noch länger?
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Die Technik ist schon vorhanden, die 99% aller Musik, die über das Internet geht, schützen könnte. Ein Missbrauch wäre so mit erheblichem Aufwand verbunden. Dies wäre so durchführbar, dass der normale Verbraucher davon nichts spüren würde.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Ich kenne viele Manager in der Musikindustrie, die das auch bedauern. Wir und die Musikindustrie sind ja keine Gegner.
Im Sinne der Super-Distribution könnte man sogar Napster wieder nutzen.
Der ursprüngliche Plan von SDMI war, einen Standard zu haben, um mit einheitlicher Konzeption für das Weihnachtsgeschäft 1999 Geräte liefern zu können. Die einheitliche Konzeption wurde inzwischen aufgegeben. Jetzt geht es darum, Anforderungen an die Sicherheit zu haben. Momentan werden mit jedem Monat die jungen Leute daran gewöhnt, dass Musik etwas ist, was man kostenlos bekommen kann, das ist eine Katastrophe.
1995 wurden wir zum ersten Mal gefragt, ob wir die Musikindustrie zerstören wollen. Eigentlich ist die Musikindustrie mit ihrer mangelnden Reaktion dafür verantwortlich, und natürlich wird mit Hilfe der CD-Brenner viel Schaden angerichtet. Die Gefahr von MP3 wird überschätzt und hochgespielt.
MP3 - so kontrovers das, was damit geschieht auch ist - hat einen gewaltigen Boom entfacht. Wie fühlt man sich als „Erfinder“?
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Das Kernteam ist zusammen geblieben. Die dunklen Jahre sind vorbei. Problem nach Problem wurde gelöst. Jetzt sind die Jahre der Ernte. Das macht Spaß.
Zielsetzung des Preises ist es, der breiten Öffentlichkeit solche Leistungen bewusst zu machen und einen Dialog zu führen - reden Sie mit der Öffentlichkeit?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Ein wichtiger Punkt sind Konferenzen und Messen, da sind wir weltweit präsent. Jeder von uns schreibt mindestens ein oder zwei Mal im Jahr Veröffentlichungen. Im Moment kommen viele Leute von selbst hierher.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Wir versuchen, so weit es uns möglich ist, Anfragen zu beantworten und uns der Diskussion zu stellen. Gerade auch über zukünftige Business-Modelle, über Anwendungen und zukünftige Entwicklungen.
Der Begriff „Innovation“ ist viel- und abgenutzt. Was bedeutet Innovation für Sie?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Neues machen. Dinge kreativ weiter entwickeln. Es ist ein kreativer Prozess.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Das Spannende ist, dass man die Nase vorn hat, dass man die neuesten Sachen macht, die es so oder besser nicht gibt.
Dipl.-Ing. Harald Popp
Durch unsere Technik erschließen wir ständig neue Anwendungen, das ist wirklich das Neue: Eine Armbanduhr, die Musik spielt, Stereoanlagen, die Festplatte und Internetanschluss haben. Neue Funktionen für die Menschen.
Wenn Sie heute vor der Entscheidung ständen, ob Sie Ihren Weg noch einmal so machen wollten, was würden Sie tun?
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Mir hat die Kombination Elektronik und Musik immer schon großen Spaß gemacht. Als sich nun diese Möglichkeit bot, war ich Feuer und Flamme.
Dipl.-Ing. Harald Popp
Für mich war es ein Glücksfall, mit den Dingen arbeiten zu können, die mir schon immer Spaß gemacht haben. Die Kombination aus Elektronik und Musik, ich hatte mir immer gerne vorgestellt, etwas damit zu machen. Keine Frage, ich würde es genau so wieder machen.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Als ich an der Universität als Assistent angefangen habe, wollte ich ein Thema von der ersten Forschung bis zur Anwendung begleiten. Damals dachte ich an einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren…
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dipl.-Ing. Harald Popp
Mehr Freizeit. Bier brauen.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Wir sind mit der Gründung der Arbeitsgruppe Elektronische Medientechnologie in Ilmenau in einer neuen Phase. Wir haben eine nächste Generation von Techniken vor Augen.
Dr.-Ing. Bernhard Grill
Wir sind mit MP3 noch immer am Anfang. Wenn niemand mehr beim Radio hören an MP3 denkt, sondern die Musik selbstverständlich über MP3 läuft, ohne dass über die Technik nachgedacht wird, dann erst kann man den gesamten Prozess der Entwicklung als Vergangenheit ansehen.
Keiner von uns fühlt sich ausgebrannt. Es gibt genügend Ideen, die man anpacken kann. Wir haben Techniken, natürliche und künstliche Inhalte zu vermischen, künstliche Realitäten zu schaffen.
Dipl.-Ing. Harald Popp
Technisch würde ich mir für mein Wohnzimmer ein besseres Klangerlebnis wünschen. Ich bin mittlerweile Surround-Sound-Fan, daheim ähnlich wie ein Kinoerlebnis. Es gibt Techniken, die eine neue Klangdimensionen schaffen können. Diese technischen Träume erleben zu können, würde mich total faszinieren.
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Brandenburg
Darauf setzen wir massiv.



 Gebärdensprache
Gebärdensprache
 Leichte Sprache
Leichte Sprache